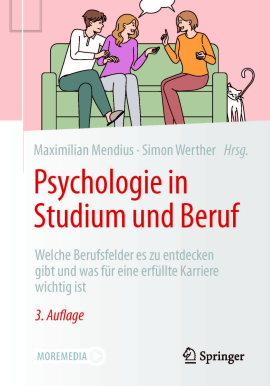Inhaltsübersicht
Kapitel 1 - Einleitung und Zielsetzung
I Berufsfelder in der klinischen Psychologie und Psychotherapie
Kapitel 3 - Grundsätzliches zum Studium der klinischen Psychologie
Kapitel 4 - Tätigkeiten in Kliniken
Kapitel 5 - Tätigkeiten in eigener Praxis
Kapitel 6 - Tätigkeiten in Beratungseinrichtungen
Kapitel 7 - Tätigkeiten in interkulturellen Kontexten
Kapitel 8 - Anforderungen an Tätigkeiten in der klinischen Psychologie
II Berufsfelder in der Wirtschaftspsychologie
Kapitel 9 - Grundsätzliches zum Studium der Wirtschaftspsychologie
Kapitel 10 - Tätigkeiten in der Arbeitspsychologie
Kapitel 11 - Tätigkeiten in der Personalpsychologie
Kapitel 12 - Tätigkeiten in der Organisationspsychologie
Kapitel 13 - Tätigkeiten in Training und Coaching
Kapitel 14 - Tätigkeiten in der Unternehmensberatung
Kapitel 15 - Tätigkeiten in der Markt- und Meinungsforschung
Kapitel 16 - Anforderungen an Tätigkeiten in der Wirtschaftspsychologie
III Berufsfelder in der pädagogischen Psychologie
Kapitel 17 - Grundsätzliches zum Studium der pädagogischen Psychologie
Kapitel 18 - Tätigkeiten im Bereich der Bildungsberatung und -evaluation
Kapitel 19 - Tätigkeiten in der Fort- und Weiterbildung
Kapitel 20 - Anforderungen an Tätigkeiten in der pädagogischen Psychologie
IV Berufsfelder in der Forschung und Lehre
Kapitel 21 - Tätigkeiten an Universitäten
Kapitel 22 - Tätigkeiten an Hochschulen
Kapitel 23 - Tätigkeiten an Forschungseinrichtungen
Kapitel 24 - Anforderungen an Tätigkeiten als Forscher:innen und Dozent:innen
V Weitere Berufsfelder
Kapitel 25 - Tätigkeiten in der Berufspsychologie
Kapitel 26 - Tätigkeiten im Bereich Data Science
Kapitel 27 - Tätigkeiten in der Familienpsychologie
Kapitel 28 - Tätigkeiten in der Friedenspsychologie
Kapitel 29 - Tätigkeiten in der forensischen Psychologie
Kapitel 30 - Tätigkeiten in der Gesundheitspsychologie
Kapitel 31 - Tätigkeiten in der klinischen Neuropsychologie
Kapitel 32 - Tätigkeiten in der Polizeipsychologie
Kapitel 33 - Tätigkeiten in der Schulpsychologie
Kapitel 34 - Tätigkeiten in der Sportpsychologie
Kapitel 35 - Tätigkeiten in der Verkehrspsychologie
VI Weitere Themen rund um den Berufseinstieg
Kapitel 37 - Vor dem Vertragsabschluss
Kapitel 38 - Selbstständigkeit
Kapitel 40 - Die Schweigepflicht als Wesensmerkmal des Psycholog:innenberufs
Kapitel 1 - Einleitung und Zielsetzung
„Faszination Psychologie“ – es fiel uns sehr leicht, uns für diesen Titel für die ersten beiden Auflagen zu entscheiden. Die Psychologie mit all ihren Eigenheiten und spannenden Facetten hat für uns Herausgeber eine besondere Bedeutung, die wir Ihnen auf den ersten Seiten gerne darstellen möchten und die auch in dieser 3. Auflage im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihr persönliches Interesse an der Psychologie und ihren vielfältigen Berufsfeldern wecken konnten und laden Sie ein, mit uns verschiedene Möglichkeiten des Psychologiestudiums kennenzulernen, spannende Berufsfelder zu entdecken und den Grundstein für eine erfüllte Karriere zu legen. Das vorliegende Buch soll und kann kein Ersatz für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Psychologie im Rahmen eines Studiums sein, sondern soll Sie dabei unterstützen, für sich zu entscheiden, welcher Beruf in einem psychologischen Tätigkeitsfeld für Sie infrage kommen könnte oder auch ob ein Studium und welches Studium der Psychologie für Sie passend ist. Dabei war es seit der 1. Auflage vor über 10 Jahren unser Anspruch, immer auch diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die die Berufsfelder der Psychologie prägen und die dazu beitragen, dass sich die Psychologie immer wieder erneuert und weiterentwickelt.
Kapitel 2 - Studienabschlüsse
Der erste Schritt zu einer spannenden Tätigkeit in einem der in den folgenden Kapiteln dargestellten Berufsfelder ist natürlich das Studium der Psychologie, das insbesondere nach der Bologna-Reform in unterschiedlichen Varianten im europäischen und internationalen Raum möglich ist. Im folgenden Kapitel fokussieren wir uns der Einfachheit halber auf deutschsprachige Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften – viele Informationen sind allerdings auch auf andere Länder übertragbar.
I Berufsfelder in der klinischen Psychologie und Psychotherapie
Kapitel 3 - Grundsätzliches zum Studium der klinischen Psychologie
Welches sind die Kernsymptome einer Schizophrenie? Welchen Fragebogen könnten Sie einsetzen, um eine Selbstauskunft über verschiedene psychopathologische Symptome zu erhalten? Welche Merkmale weisen erfolgreiche Präventionsprogramme auf? Welche Verfahren haben sich in der Behandlung von Phobien als wirksam herausgestellt? Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Studiums mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie bzw. Psychotherapie sollten Sie in der Lage sein, die oben aufgeführten Fragen zu beantworten. Im Studium der klinischen Psychologie und Psychotherapie wird über Beschreibung, Diagnostik, Prävention und Therapie von Störungen des menschlichen Erlebens und Verhaltens gelehrt. In diesem Rahmen kommt auch den Grundlagenfächern wie z. B. der Allgemeinen Psychologie oder der Biologischen Psychologie eine große Bedeutung zu, da die dort behandelten Prinzipien einen wichtigen Beitrag zum Verständnis klinischer Störungsbilder und Therapieformen leisten.
Kapitel 4 - Tätigkeiten in Kliniken
Eine gängige Definition findet sich bei Brockhaus: „Die Psychiatrie ist ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Erkennung und Behandlung, sowie Rückfallverhütung psychischer Störungen befasst“ (Brockhaus-Enzyklopädie, Mannheim 2006, Band 22, S. 233). Diese Definition ist allgemein formuliert und gilt sowohl für Psychiatrien für Erwachsene als auch für Spezialisierungen nach bestimmten Altersgruppen, wie z. B. Kinder- und Jugendpsychiatrien oder Gerontopsychiatrien für ältere Patienten. In diesem Kapitel wird das Tätigkeitsfeld für Psycholog:innen in einer Klinik bzw. Psychiatrie mit allen damit verbundenen Besonderheiten dargestellt.
Kapitel 5 - Tätigkeiten in eigener Praxis
In diesem Kapitel wird die Tätigkeit von Psycholog:innen in eigener Praxis, insbesondere niedergelassenen Psychologischen Psychotherapeut:innen vorgestellt. Nach dem Psychologiestudium kann eine psychotherapeutische Ausbildung, wahlweise für Kinder und Jugendliche und/oder Erwachsene begonnen werden, mit der Option in einer Klinik oder in eigener Praxis Patient:innen psychotherapeutisch zu behandeln. Auch ist es möglich, als Psycholog:in ohne Psychotherapieausbildung selbstständig in eigener Praxis zu arbeiten. Laut Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) nahmen 2020 31.308 Psychologische Psychotherapeut:innen an der vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland teil, dabei liegt der Anteil an Psychologischen Psychotherapeut:innen, die Teilzeit tätig sind bei 63,6 % (KBV, 2021). Anhand eines anschaulichen Beispiels wird der Alltag einer Psychologischen Psychotherapeutin beschrieben sowie im Anschluss auf die Anforderungen und Rahmenbedingungen der Tätigkeit als selbstständige:r Psychotherapeut:in eingegangen. Zum Abschluss gewährt uns ein Experteninterview mit Frau Dr. Stäbler einen persönlichen Einblick in den Alltag einer selbstständigen Psychotherapeutin.
Kapitel 6 - Tätigkeiten in Beratungseinrichtungen
In diesem Kapitel wird die Tätigkeit als Psycholog:in in dem spannenden und vielfältigen Berufsfeld der Beratungsstellen vorgestellt. Erwähnt werden soll an dieser Stelle vor allem die Vielfalt an verschiedenen Beratungsstellen: Es gibt Beratungsstellen für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstellen), Ehe-, Paar- und Lebensberatungsstellen (EPFL), Schwangerschaftsberatungsstellen, Kinderschutzzentren, Beratungsstellen für Psychische Gesundheit (SPDi), Beratungsstellen/Psychologische Dienste für Ausländer, Beratungsstellen bei Missbrauch (für Mädchen/Frauen und Jungen/Männer), Beratungsstellen für Essstörungen, Suchtberatungsstellen, Beratungsstellen bei Suizidgefährdung, Beratungsstellen mit Schwerpunkt Trennung und Scheidung. Diese Aufzählung ist sicherlich nicht vollständig und soll auch nur das breite Spektrum an psychosozialen Hilfen verdeutlichen. Kennzeichen aller Beratungsstellen ist ihre Kostenfreiheit (zumeist Mischfinanzierungen durch den Träger, die Kommune, den Bezirk und das Bundesland; mitunter auch Beteiligung durch den Gesundheitsbereich) und der niedrigschwellige Zugang für die Klientel. Die Tätigkeit unterscheidet sich hinsichtlich der jeweiligen Themenschwerpunkte der Beratungsstelle.
Kapitel 7 - Tätigkeiten in interkulturellen Kontexten
In diesem Kapitel wird aufgezeigt, warum eine kultursensible Vorgehensweise, insbesondere durch die Berücksichtigung der Gruppenzugehörigkeitsmerkmale Kultur, Migrations- und Fluchterfahrungen die Beratungs- und psychotherapeutische Arbeit in interkulturellen Kontexten einerseits erfolgreich und effektiv für die Klient:innen und Patient:innen, andererseits spannend, zufriedenstellend und nie langweilig für die Beratenden und psychotherapeutisch Tätigen macht. Zunächst wird die Diversität der Klientel und Patient:innenschaft beschrieben, dann werden die interkulturellen Kontexte näher betrachtet und eine zentrale Handlungskompetenz für die Arbeit in interkulturellen Kontexten vorgestellt. Anschließend wird die Berücksichtigung der Gruppenmerkmale Kultur, Migrations- und Fluchterfahrungen im Rahmen der Tätigkeit als Psychologische Psychotherapeutin dargestellt.
Kapitel 8 - Anforderungen an Tätigkeiten in der klinischen Psychologie
Im Folgenden soll ein Überblick bezüglich der Anforderungen gegeben werden, die an Psycholog:innen gestellt werden, die sich für eine Beschäftigung in einem klinischen Tätigkeitsfeld entscheiden. Dabei werden die – für die meisten klinischen Tätigkeitsfelder gültigen – fachlichen und überfachlichen Anforderungen dargestellt. Schließlich werden Anregungen gegeben, wie bereits im Studium einige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewährung in einem klinischen Berufsumfeld gelegt werden können. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass es aufgrund der Vielfalt der klinischen Theorieschulen und verschiedenster Karrierewege kein Patentrezept gibt, das perfekt auf den Berufseinstieg vorbereitet. Hinter jeder Karriere steht eine individuelle Geschichte, wie auch in den Experteninterviews aus den vorangegangenen Kapiteln deutlich wird.
II Berufsfelder in der Wirtschaftspsychologie
Kapitel 9 - Grundsätzliches zum Studium der Wirtschaftspsychologie
Wie muss der Arbeitsplatz in einem Unternehmen gestaltet sein, damit Mitarbeitende bestmöglich arbeiten können? Wie lassen sich passende, qualifizierte Mitarbeitende für offene Stellen in einem mittelständischen Unternehmen auswählen? Wie lässt sich eine Mitarbeitendenbefragung in einem Großkonzern umsetzen? Wie lässt sich untersuchen, welche Produkte von Konsument:innen präferiert werden und wie Werbekampagnen zur Vermarktung dieser Produkte am besten gestaltet werden können? Mit diesen Fragen beschäftigen Sie sich im Rahmen eines Studiums mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Die Bandbreite der Anwendungsszenarien der Wirtschaftspsychologie ist dabei breit gefächert, was in den folgenden Kapiteln sehr deutlich wird – von Organisationspsychologie über Training und Coaching bis hin zu Marktforschung handelt es sich um ein vielfältiges Spektrum an teilweise sehr unterschiedlichen Tätigkeiten. Dabei können Sie Wirtschaftspsychologie an den meisten Universitäten sowohl im Bachelor als auch im Master studieren bzw. als Schwerpunkt wählen.
Kapitel 10 - Tätigkeiten in der Arbeitspsychologie
Was haben Ihr Smartphone, das Surfen im Internet, Ihr Drehstuhl, der Schutzhelm auf der Baustelle und Ihre erfolgreiche Suche nach einem passenden Tätigkeitsfeld gemeinsam? Die Antwort ist: Arbeitspsychologie! Denn überall stehen im Hintergrund auch Überlegungen von Arbeitspsycholog:innen, die an der intuitiven Bedienbarkeit Ihres Smartphones, der Usability von Internetseiten, der ergonomischen Gestaltung des Bürostuhls, an der Arbeitssicherheit auf Baustellen oder an Beratungen, Büchern und Online-Tools im Bereich Berufsfindung (mit-)arbeiten. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über Tätigkeit und Aufgaben in unterschiedlichen arbeitspsychologischen Praxisfeldern und über typische Arbeit- bzw. Auftraggeber:innen. Sie lernen sowohl die Sichtweise eines Wissenschaftlers zu diesem Berufsfeld, als auch die einer Praktikerin kennen. Und Sie erfahren, was Sie selbst mitbringen sollten, wenn Sie in diesem Bereich tätig werden möchten, welche Anforderungen an persönliche, fachliche und methodische Kompetenzen gestellt werden. Einleitend lernen Sie eine typische Situation in der Arbeitswelt kennen, in der eine Organisation auf die Dienste einer Arbeitspsychologin zurückgreift.
Kapitel 11 - Tätigkeiten in der Personalpsychologie
Die Personalpsychologie, deren Wurzeln bereits in der Psychotechnik aus dem frühen 20. Jahrhundert liegen, gehört sicherlich zu den am längsten etablierten Disziplinen der Arbeits- und Organisationspsychologie. Personalpsychologen befassen sich mit vielfältigen Fragestellungen der Auswahl, Beurteilung und Entwicklung von Mitarbeiter:innen und Führungskräften unter der Nutzung verschiedener diagnostischer Methoden. Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die Aufgabengebiete und Besonderheiten der personalpsychologischen Arbeit und fokussiert dabei schwerpunktmäßig auf die Bereiche Eignungs- und Entwicklungsdiagnostik und Beurteilung. Auf die Ausgestaltung von Personalentwicklungsmaßnahmen wird im ► Kap. 13 sowie im ► Kap. 19 näher eingegangen.
Kapitel 12 - Tätigkeiten in der Organisationspsychologie
Der Kernnutzen von Organisationspsycholog:innen ist es, Organisationen beim Erreichen ihrer Ziele durch das Gestalten von Organisationselementen zu unterstützen. Organisationsziele sind zu einem Teil primär businessgetrieben. Organisationen haben aber auch Image- und Nachhaltigkeitsziele oder organisationsinterne Ziele, wie z. B. das Verbessern von Qualitäts- oder Gesundheitsquoten. Gestaltbare Organisationselemente können über verschiedene Zugangskanäle gefunden werden. Begreift man Organisation als Kontext, finden sich Variablen wie die Strategie, Strukturen und Prozesse oder auch die Gestaltung von Arbeitsplätzen und -abläufen. Sieht man die Organisation als soziales System, würde man beispielsweise die Interaktion zwischen Schlüsselakteuren der Organisation ganz gezielt gestalten. Solche Schlüsselakteure sind das Top Management, das Mittlere Management, Führungskräfte auf unteren Ebenen, Mitarbeiter:innen als Teams und der/die Einzelne. Neben grundlegenden Techniken wie Formaten für Kommunikation, Interaktion und Dialog können Organisationspsycholog:innen Hinweise zur Gestaltung von sozialen Systemen aus Erkenntnissen der Sozialpsychologie ableiten, beispielsweise bei der Gestaltung von Gruppenzielen, dem Grad an Autonomie bei Entscheidungen im Team oder dem Zusammenspiel von Entlohnungssystemen auf Team- und Individualebene.
Kapitel 13 - Tätigkeiten in Training und Coaching
Tätigkeiten als Trainer:in oder Coach:in sind ein häufiges Einsatzfeld von Psycholog:innen. Dabei können zum einen klassische wirtschaftspsychologische, zum anderen aber auch allgemeine psychologische Themengebiete im Vordergrund stehen. Das liegt insbesondere daran, dass durch das Studium der Psychologie als Wissenschaft des Erlebens und Verhaltens des Menschen zahlreiche Grundlagen und anwendungsbezogene Inhalte vermittelt werden, die für Trainer:innen oder Coach:innen wichtig sind. In diesem Kapitel wird anhand eines Szenarios ein typisches Beispiel für einen Trainings- und Coachingprozess dargestellt. Darüber hinaus werden wichtige Rahmenbedingungen dieses Tätigkeitsfelds sowie damit verbundene Zugangsvoraussetzungen erörtert. Der Fokus ist auf die Tätigkeit als freiberufliche:r und selbstständige:r Trainer:in oder Coach:in gerichtet, wohingegen im ► Kap. 19 die Fort- und Weiterbildung für Erwachsene in Institutionen unterschiedlichster Art als Tätigkeitsfeld dargestellt wird.
Kapitel 14 - Tätigkeiten in der Unternehmensberatung
Ein Tätigkeitsfeld, das über die letzten Jahre beständig gewachsen ist und das Absolvent:innen nahezu aller Studiengänge interessante Berufsperspektiven bieten kann, ist die Unternehmensberatung. Als Unternehmensberater:in führt man im Kundenauftrag definierte Aufgabenpakete aus, die der/die Kund:in entweder nicht alleine ausführen kann oder will. Im Folgenden wird dargestellt, in welchen Kontexten Psycholog:innen als Unternehmensberater:innen agieren und welchen Mehrwert sie in dieser Branche stiften können. Anhand eines Beispiels wird zunächst eine typische Situation dargestellt, in der eine Organisation auf die Dienste einer Beratung zurückgreift. In den folgenden Abschnitten wird dann auf die Besonderheiten dieses Berufsfelds eingegangen und es wird skizziert, welche Rolle Psycholog:innen in diesem Kontext spielen können. Ein Expertinneninterview mit einer erfahrenen Unternehmensberaterin bildet den Abschluss des Kapitels.
Kapitel 15 - Tätigkeiten in der Markt- und Meinungsforschung
Die Tätigkeit als Markt- und Meinungsforscher:in ist ein Einsatzgebiet, in dem eine Vielzahl von Personen unterschiedlicher Studienhintergründe zusammentreffen. Möglicherweise ist es aus diesem Grund ein wenig behandelter Bereich im wirtschaftspsychologischen Studium. Dennoch bieten sich für Psycholog:innen hierbei vielseitige Möglichkeiten. Ein:e Marktforscher:in kann sowohl auf der Seite einer Agentur für Unternehmen Marktforschungsprojekte durchführen als auch als Auftraggeber:in direkt auf betrieblicher Seite arbeiten. In diesem Kapitel wird das Berufsfeld von Markt- und Meinungsforschenden anhand eines praktixnahen Szenarios vorgestellt und es werden typische Fragestellungen erläutert. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung der organisationalen sowie branchenspezifischen Struktur des Berufsfelds, der Rolle, die ein:e Psycholog:in darin einnimmt, sowie in den Voraussetzungen und Kenntnissen, die einem:r Psycholog:in den Einstieg in diesem Bereich erleichtert.
Kapitel 16 - Anforderungen an Tätigkeiten in der Wirtschaftspsychologie
Die vielfältigen Berufsfelder in der Wirtschaftspsychologie wurden in den vorherigen Kapiteln detailliert dargestellt. Dabei wird deutlich, dass es sich um ein sehr vielfältiges Tätigkeitsfeld mit unterschiedlichen Anforderungen handelt. In diesem Kapitel wird deshalb ein Überblick über allgemeine und übergreifende Anforderungen der wirtschaftspsychologischen Tätigkeitsfelder gegeben. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Überschneidungen mit anderen psychologischen Berufsfeldern, die z. B. in den Kap. ► 19 oder Kap. ► 30 beschrieben werden.
III Berufsfelder in der pädagogischen Psychologie
Kapitel 17 - Grundsätzliches zum Studium der pädagogischen Psychologie
Gegenstand der pädagogischen Psychologie ist die Beschreibung und Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens in Erziehungs-, Lern- und Unterrichtssituationen. Dabei können sowohl institutionalisierte Lern- und Sozialisationsprozesse betrachtet werden (z. B. in der Schule oder in der Kindertagesstätte) als auch nichtinstitutionalisierte, wie sie z. B. in der Familie stattfinden. Historisch betrachtet ist die pädagogische Psychologie eines der ältesten Anwendungsfächer der Psychologie. Zahlreiche Begriffe und Theorien (wie z. B. das Konzept des Intelligenzquotienten, IQ) entstanden ursprünglich in einem pädagogischen Kontext. Das Fach weist eine große Nähe zu anderen Disziplinen auf: Fragestellungen der pädagogischen Psychologie werden z. B. auch in den Erziehungswissenschaften oder der empirischen Pädagogik aufgegriffen.
Kapitel 18 - Tätigkeiten im Bereich der Bildungsberatung und -evaluation
Die deutsche Bildungslandschaft befindet sich im permanenten Wandel. Der Begriff des „Lebenslangen Lernens“ ist in aller Munde und die Erkenntnis, dass Bildung lange vor der Schule beginnt und im Grunde nie endet, hat sich in weiten Kreisen durchgesetzt. Die PISA-Studien der OECD haben der Öffentlichkeit eindrücklich vor Augen geführt, wie stark der individuelle Schulerfolg eines Kindes vom sozialen Umfeld und dem Bildungshintergrund der Eltern abhängig ist. Entsprechend sollen Kinder bereits vor dem Eintritt in die Grundschule individuell gefördert werden, weshalb seit ein paar Jahren auch Kitas, also Kindertagesstätten (d. h. Krippen, Kindergärten und Horte) als Bildungsorte verstanden werden. Die zunehmende Flexibilisierung am Arbeitsmarkt und die wachsende Vielfalt in unserer Gesellschaft stellen die deutschen Bildungssysteme vor zusätzliche Herausforderungen. Es gilt, Betreuungsmodelle und Schulformen zu entwickeln, die zum einen Forderungen aus Politik und Wirtschaft aufgreifen und zum anderen das Wohl des einzelnen Kindes nicht aus den Augen verlieren.
Kapitel 19 - Tätigkeiten in der Fort- und Weiterbildung
Im Studium der Psychologie beschäftigt man sich ausführlich mit dem Themenkomplex „Lernen und Entwicklung“. Eine Tätigkeit in der Fort- und Weiterbildung ist deshalb ein mögliches Berufsfeld für Psycholog:innen, das in diesem Kapitel näher vorgestellt wird. Zunächst soll ein Beispielszenario einen realistischen Einblick in die Tätigkeit gewähren. Im Anschluss wird auf die charakteristischen Merkmale dieses Berufsfelds eingegangen. Zudem wird beschrieben, welchen Beitrag Psycholog:innen in diesem Berufsfeld leisten können, und skizziert, wie man sich während des Studiums auf diese Tätigkeit vorbereiten kann. Das Kapitel wird abgerundet durch ein Expertinneninterview mit einer erfahrenen Psychologin, die über langjährige Erfahrung in vielfältigen Bereichen der Fort- und Weiterbildung verfügt. Während in ► Kap. 13 insbesondere das Berufsfeld von freiberuflichen Trainer:innen vorgestellt wird, bezieht sich dieser Beitrag auf die Rolle von Psycholog:innen in der Fort- und Weiterbildung, die für eine Organisation (beispielsweise Unternehmen oder Institution) tätig sind.
Kapitel 20 - Anforderungen an Tätigkeiten in der pädagogischen Psychologie
In den vorangehenden Kapiteln wurden die Tätigkeiten von pädagogischen Psycholog:innen vorgestellt, die in staatlichen Bildungseinrichtungen sowie in der Fort- und Weiterbildung arbeiten. Im folgenden Beitrag wird dargestellt, wie diese beiden Tätigkeiten zusammenhängen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen. Es wird skizziert, in welcher Form bestimmte Kompetenzen von Psycholog:innen für die jeweiligen Tätigkeitsfelder bedeutsam sind. Hierbei wird besonders auf den unterschiedlichen Einsatz von Methodenkompetenzen in beiden Tätigkeitsfeldern eingegangen. Zudem wird herausgearbeitet, in welchen interdisziplinären Kontext beide Tätigkeiten eingebettet sind. Abschließend wird diskutiert, welche Implikationen die unterschiedlichen Kompetenzprofile beider Tätigkeitsfelder für die Schwerpunktsetzung während des Psychologiestudiums haben können.
IV Berufsfelder in der Forschung und Lehre
Kapitel 21 - Tätigkeiten an Universitäten
Das folgende Kapitel bezieht sich auf Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen von Psycholog:innen, die an Universitäten beschäftigt sind und dort vorrangig Aufgaben im Bereich der Forschung und Lehre übernehmen. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt hierbei auf Wissenschaftler:innen in vergleichsweise frühen Karrierephasen, die häufig als wissenschaftliche Mitarbeiter:innen angestellt sind und sich im Rahmen ihrer Beschäftigung auf weitere Tätigkeiten innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft qualifizieren. Ergänzend werden zudem Anforderungen und Tätigkeitsfelder im Rahmen von Professuren und damit in fortgeschrittenen Karrierephasen in den Blick genommen. Anhand eines Beispielszenarios wird zunächst ein typischer Arbeitstag einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin dargestellt, die gerade letzte Vorbereitungen für eine Datenerhebung trifft und Unterlagen für eine Seminarsitzung erstellt. Daraufhin werden konkrete Tätigkeiten wie z. B. Datenauswertung und Manuskripterstellung beschrieben und die Anforderungen an Psycholog:innen in diesem Berufsfeld erläutert. Ergänzt wird das Kapitel um ein Expert:inneninterview mit einer Juniorprofessorin.
Kapitel 22 - Tätigkeiten an Hochschulen
„Stell dir vor, ich habe gerade eine Kollegin kennengelernt, die mit 37 Jahren schon Professorin ist und das ohne Habilitation!“. Dieser Satz fiel kürzlich auf einem Psychologiekongress in Bonn im Gespräch zweier erfahrener Wirtschaftspsycholog:innen. Wie diesen beiden ist auch vielen weiteren Psycholog:innen eine attraktive Karriereoption wenig präsent, nämlich die Hochschulprofessur. Mit Hochschule sind in diesem Beitrag alle Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technische Hochschulen gemeint, ob in staatlicher, kirchlicher oder privater Trägerschaft. Dazu gehören auch Verwaltungsfachhochschulen und Duale Hochschulen. Die Hochschule eröffnet einigen Psycholog:innen die Möglichkeit auf eine zweite Karriere, nachdem sie bereits einige Jahre in der Forschung und in der psychologischen Berufspraxis tätig waren. Das Tätigkeitsfeld an Hochschulen unterscheidet sich dabei wesentlich von dem an Universitäten (► Kap. 21), daher wird es in diesem Kapitel gesondert vorgestellt.
Kapitel 23 - Tätigkeiten an Forschungseinrichtungen
Dieses Kapitel stellt die Tätigkeit von Psycholog:innen an Forschungseinrichtungen vor und bezieht sich dabei vorrangig auf den Bereich der Grundlagenforschung. Bei einer Forschungseinrichtung handelt es sich um eine (meist zumindest teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierte) Institution, die sich zum Ziel gesetzt hat, zu einem oder mehreren Themen wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Größtenteils verfügt die jeweilige Einrichtung über ein eigenes Budget und ist finanziell und organisatorisch von Universitäten unabhängig. Oftmals bestehen jedoch Kollaborationen mit universitären Instituten. Die 2012 beschlossene Neuerung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes („Gesetz zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen“) verstärkt die Autonomie der öffentlichen Forschungsinstitutionen. Somit können die Institute ihre Schwerpunkte und deren Finanzierung so frei wie möglich regeln, was den hier tätigen Forscher:innen ein großes Maß an Flexibilität bietet. Die Tätigkeit an Forschungsinstituten ähnelt in vielen Aspekten der an Universitäten, es gibt jedoch auch Unterschiede, wie im Folgenden dargestellt wird.
Kapitel 24 - Anforderungen an Tätigkeiten als Forscher:innen und Dozent:innen
Während in den vorangegangenen Kapiteln die Tätigkeiten von Psycholog:innen an Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen bereits detailliert beschrieben wurden, werden in diesem Kapitel die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der jeweiligen Anforderungen an Forscher:innen und Dozent:innen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Universitäten und Forschungsinstituten dargestellt. Nach einer allgemeinen Einführung mit Blick auf Arbeitsbedingungen und Arbeitszufriedenheit werden die jeweils spezifischen Anforderungen an Psycholog:innen an Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen miteinander verglichen.
V Weitere Berufsfelder
Kapitel 25 - Tätigkeiten in der Berufspsychologie
Dieses Kapitel bezieht sich auf die Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen von Psycholog:innen, die im Bereich der Berufspsychologie tätig sind. Dort übernehmen sie Aufgaben der Diagnostik und Beratung. Anhand eines Szenarios wird zunächst ein typischer Arbeitsalltag einer Psychologin dargestellt, die diagnostische Gespräche führt und Testergebnisse auswertet, diese und weitere Befunde (z. B. Verhaltensbeobachtungen, Vorinformationen wie Zeugnisse) zu einem Gesamturteil aggregiert und Gutachten verfasst. Des Weiteren trifft sie an diesem beispielhaften Tag Vorbereitungen für eine Schulung und führt ein psychologisches Beratungsgespräch durch. Daraufhin werden konkrete Tätigkeiten beschrieben und die Anforderungen in diesem Berufsfeld erläutert. Den Abschluss des Kapitels bildet ein Experteninterview mit Silvia Weiland (Agenturpsychologin bei der Bundesagentur für Arbeit).
Kapitel 26 - Tätigkeiten im Bereich Data Science
Tagtäglich werden wir mit der Arbeit von Data Scientists konfrontiert. Sei es bei der Betrachtung unserer durchschnittlichen Herzrate und Schlafdauer in einer Fitness-App, beim Öffnen der Netflix-Startseite, die uns individuelle Filmvorschläge anzeigt, oder auch bei Prognosen, welche Parteien bei anstehenden Wahlen voraussichtlich das Rennen machen werden. Bei der Analyse und Vorhersage von menschlichem Verhalten und Erleben ergänzen sich Data Science und Psychologie perfekt und bilden eine spannende Mischung.
Kapitel 27 - Tätigkeiten in der Familienpsychologie
Jeder Mensch wird in eine Familie hineingeboren und seine individuelle Entwicklung und Sozialisation hängt maßgeblich davon ab, welche Erfahrungen er als Kind in dieser Familie macht. Auch Erwachsene sind in mannigfaltiger Weise in familiäre Beziehungen eingebunden und bleiben ein Leben lang mit ihrer Herkunftsfamilie verknüpft, was je nach Art der Verknüpfung eher als Belastung oder als Ressource und Kraftquelle erlebt werden kann. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheiten und Umbrüche weisen viele Menschen der Familie einen hohen Stellenwert zu. Dementsprechend spielt der familiäre Kontext, in den die Menschen eingebunden sind, in den meisten Tätigkeitsfeldern der psychologischen Praxis eine mehr oder weniger große Rolle. In diesem Kapitel wird näher beleuchtet, welche Wege man einschlagen kann, wenn man in dem überaus interessanten und vielfältigen Gebiet der Familienpsychologie tätig werden will.
Kapitel 28 - Tätigkeiten in der Friedenspsychologie
Die Friedenspsychologie ist unter den Fachgebieten der Psychologie eine junge Disziplin, die der Sozialpsychologie und zum Teil auch der politischen Psychologie zugeordnet wird und eng mit der interdisziplinären Friedens- und Konfliktforschung verflochten ist. Sie beinhaltet psychologische Tätigkeiten in Forschung und Praxis, die auf einen möglichst gewaltfreien Konfliktaustrag auf unterschiedlichen Ebenen, die Vermeidung, aber auch die Beendigung von Krieg durch Verhandlungslösungen, die Förderung von nachhaltigem Frieden und auf die Verwirklichung politischer, ökonomischer, ökologischer und sozialer Gerechtigkeit abzielen. Die nachfolgenden Ausführungen sollen Ihnen einen Einblick in ein junges und vielversprechendes neues Berufsfeld geben.
Kapitel 29 - Tätigkeiten in der forensischen Psychologie
Der Beruf des forensischen Psychologen gehört zu den immer noch wenig bekannten potenziellen Tätigkeitsfeldern. Nicht selten sind die Vorstellungen darüber von (medial vermittelten) Vorurteilen geprägt, die mit der tatsächlichen Praxis oft nicht übereinstimmen. Im Folgenden sollen daher aufbauend auf einem typischen Szenario aus der Praxis die vielfältigen Aufgaben des forensisch tätigen Psychologen und die Besonderheiten dieses Berufsfeldes dargestellt werden.
Kapitel 30 - Tätigkeiten in der Gesundheitspsychologie
Die Gesundheitspsychologie ist eine der jüngsten Disziplinen der Psychologie. Entsprechend neu sind auch die Tätigkeitsfelder, die sich in diesem Fachbereich eröffnen. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fort- und Weiterbildung oder die Koordination und Durchführung von Gesundheitsprojekten sind Beispiele dafür, in welchen Berufsfeldern Gesundheitspsycholog:innen tätig sind. Die Möglichkeiten sind vielfältig, wobei sich die konkreten Betätigungsfelder in Zukunft stark weiterentwickeln werden, da die heute tätigen Gesundheitspsycholog:innen in vielen Fällen noch Pionierarbeit leisten. Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, als Gesundheitspsycholog:in zu arbeiten.
Kapitel 31 - Tätigkeiten in der klinischen Neuropsychologie
Die klinische Neuropsychologie gewinnt gerade in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt auch bedingt durch die Corona-Pandemie und das Auftreten von Long Covid, rasant an Bedeutung. Seit der im Jahr 2020 in Kraft getretenen Reform des Psychotherapeutengesetzes ist die neuropsychologische Psychotherapie neben der Psychotherapie für Erwachsene und der für Kinder und Jugendliche die dritte Versorgungssäule (PsychThG). Dies unterstreicht die Wichtigkeit in der Versorgung von Menschen mit erworbener Hirnschädigung und stellt einen bedeutsamen Schritt zur langfristigen Verbesserung der Versorgung für Menschen mit verletzungs- oder erkrankungsbedingten Hirnfunktionsstörungen dar. Im folgenden Kapitel wird das Tätigkeitsfeld des/der klinischen Neuropsycholog:in praxisnah vorgestellt und der entsprechende Ausbildungsweg skizziert.
Kapitel 32 - Tätigkeiten in der Polizeipsychologie
Polizeipsychologie ist kein großes, aber im Gegenzug sehr vielfältiges Arbeitsgebiet für Psycholog:innen. Bereits seit den Anfängen der wissenschaftlichen Psychologie wurden und werden Psychologinnen und Psychologen in den Bereichen Polizei und Strafverfolgung hinzugezogen. Mittlerweile ist die Psychologie aus der Polizei nicht mehr wegzudenken und umfasst so verschiedene Anwendungsbereichen wie Beratung und Betreuung von Polizist:innen, Personalauswahl und -entwicklung, Aus- und Fortbildung oder Unterstützung bei Einsätzen und Ermittlungen.
Kapitel 33 - Tätigkeiten in der Schulpsychologie
Schulpsychologische Arbeit wird zunehmend wichtiger. Die Krisen der letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig die psychologische Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, ihren Eltern und Lehrkräften ist. Während der Corona-Pandemie und der Schulschließungen nahmen Ängste und depressive Episoden bei Kindern und Jugendlichen deutlich zu. Auch die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten verunsichern viele.
Kapitel 34 - Tätigkeiten in der Sportpsychologie
„Gut sein, wenn’s drauf ankommt!“ – Das ist das, sehr allgemein und unter Vorbehalt zusammengefasste, Motto der Sportpsychologie. Bei der Sportpsychologie handelt es sich um ein relativ junges Fachgebiet der Psychologie, dessen Relevanz in den letzten Jahren jedoch deutlich angestiegen ist. Das liegt mitunter daran, dass das Erbringen von Höchstleistungen zu einem gewissen Zeitpunkt nicht nur im Sport, sondern auch in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft mittlerweile eine zentrale Rolle spielt. Ebenso wie die Anwendungsbereiche ist auch der Beruf der Sportpsychologie sehr vielfältig, was im Laufe dieses Kapitels deutlich werden wird. Im Folgenden soll zunächst eine typische Situation aus der Sportpsychologie das Tätigkeitsfeld anschaulich beschreiben.
Kapitel 35 - Tätigkeiten in der Verkehrspsychologie
Die Verkehrspsychologie kann für sich in Anspruch nehmen, eine der ältesten psychologischen Disziplinen zu sein. Seit Münsterbergs Untersuchungen (1912) an Straßenbahnfahrern ist im deutschsprachigen Raum das Hauptarbeitsfeld von Verkehrspsychologen die Diagnostik der Eignung zum Führen von Fahrzeugen. Heute sind über 1000 Verkehrspsychologen sowohl mit der Diagnostik (medizinisch-psychologische Untersuchung, MPU) als auch mit der Verbesserung (Nachschulung, Verkehrsrehabilitation, Driver Improvement) der Fahreignung beschäftigt. Als kleinere, aber beständig wachsende Berufsfelder sind die ergonomische Verkehrspsychologie sowie die Mobilitätspsychologie hervorzuheben. Relativ wenige Psychologen sind mit verkehrspädagogischen Inhalten betraut.
VI Weitere Themen rund um den Berufseinstieg
Kapitel 36 - Bewerbung
Vor Abschluss eines Studiums stellen wir uns oftmals die Frage: Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte? Für viele Absolventinnen und Absolventen ist der naheliegende erste Schritt die Bewerbung. Diese erfordert einiges an Zeit und Energie, denn wir müssen uns nicht nur mit der Frage beschäftigen, wie man attraktiv für den Arbeitsmarkt ist, sondern auch damit, was wir eigentlich wollen. Dies gilt für eine Bewerbung im Unternehmen genauso wie für eine klinische oder soziale Einrichtung oder auch für den Schritt in die Selbstständigkeit oder das Gründen. Wenn man die ersten Bewerbungen abgeschickt hat, kann man Glück haben und bald eine Zusage erhalten, oftmals dauert es aber auch Monate, bis der passende Job gefunden ist. Hier gilt es durchzuhalten und die Bewerbungen immer wieder auf die jeweiligen Stellen anzupassen und ggf. zu verbessern. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher mit dem Thema Bewerbung, mit Hilfen bei der Entscheidungsfindung sowie mit dem Umgang mit Arbeitslosigkeit während der Bewerbungsphase.
Kapitel 37 - Vor dem Vertragsabschluss
In den meisten Fällen beginnt die berufliche Karriere in einem Angestelltenverhältnis. Haben Sie basierend auf Ihren Präferenzen und Kompetenzen eine/n Arbeitgeber:in identifiziert und war Ihr Bewerbungsprozess erfolgreich, so wird man Ihnen im Regelfall einen Arbeitsvertrag zukommen lassen. Bis vor Kurzem war es möglich, Arbeitsverträge mündlich abzuschließen, mit der Neuregelung des Nachweisgesetzes sind nun jedoch sämtliche Arbeitgeber:innen verpflichtet, Ihnen einen schriftlichen Vertrag mit sämtlichen relevanten Bestandteilen zur Verfügung zu stellen. Von dieser Möglichkeit sollten Sie dringend Gebrauch machen, da sonst bei etwaigen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen Wort gegen Wort steht und damit ein Ausgang des Verfahrens mehr von der Willkür, als von der realen Faktenlage abhängen kann. In diesem Kapitel werden Empfehlungen gegeben, welche Rahmenbedingungen Ihrer Angestelltentätigkeit Sie mit künftigen Arbeitgebenden abklären und ggf. im Arbeitsvertrag fixieren sollten, bevor Sie diesen unterschreiben.
Kapitel 38 - Selbstständigkeit
Die Frage „was will ich?“ beantworten viele mit der Aussage „ich möchte mein eigener Chef/meine eigene Chefin sein“. In Deutschland sind in der Sparte selbstständige freie Heilberufe die Ärzte die Berufsgruppe, welche am häufigsten selbstständig ist. Ein Großteil der Psychologen und Psychologinnen geht ins klinische, therapeutische Umfeld. Dabei sind sie oftmals angestellt oder gründen eigene Praxen. Auch in anderen Bereichen, kann die Selbstständigkeit ein passendes berufliches Umfeld bieten. Die neuesten Berufsbilder, auch als kurze Videoclips, gibt es bei der DGPs.
Kapitel 39 - Arbeitslosigkeit
Auf den vorherigen Seiten haben wir uns immer wieder mit Kompetenzen und den eigenen Wünschen beschäftigt, welche als Ziel die „Beschäftigung“ oder eine Arbeit haben. Manchmal klappt es jedoch nicht immer so, wie man gerade möchte, oder es gibt wirtschaftliche Umstände, die einen in die Arbeitslosigkeit schicken. Die Arbeitslosigkeit und alleine der Gedanke daran können Angst machen. Man denkt vielleicht, dass man nicht gut genug ist für den Arbeitsmarkt, man hat Angst, seine Lebenshaltungskosten nicht decken zu können, vielleicht schämt man sich sogar und verheimlicht seine Arbeitslosigkeit. Auch wenn es kein gutes Gefühl ist, arbeitslos zu sein oder keine Aufträge zu haben, der Gedanke daran gehört zum heutigen Alltag.
Kapitel 40 - Die Schweigepflicht als Wesensmerkmal des Psycholog:innenberufs
Psycholog:innen lernen, sich für ihre Klient:innen und Patient:innen einzusetzen, dem in sie gesetzten Vertrauen gerecht zu werden und sie in ihrer Autonomie zu respektieren. Das betrifft insbesondere die Schweigepflicht, die für Psycholog:innen sogar strafbewehrt ist. Dass ihre Geheimnisse vertraulich bleiben, darauf müssen sich Klient:innen und Patient:innen von Psycholog:innen verlassen können. Dass Psycholog:innen diese Rolle auch ethisch verinnerlicht haben, zeigt das im Exkurs dargestellte Beispiel zur Schweigepflicht.
Kapitel 41 - Ausblick
Wir hoffen, unsere gemeinsame Reise durch die vielfältigen Betätigungsfelder von Psycholog:innen im Arbeitsleben hat Sie inspiriert und Sie haben daraus die richtigen Schlüsse für Ihre eigene berufliche Entwicklung gezogen.