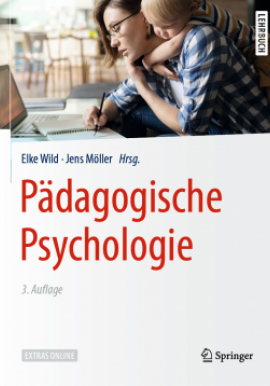Lernen
Kapitel 1: Wissenserwerb
Kapitel 2: Intelligenz und Vorwissen
Kapitel 3: Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen
Lehren
Kapitel 4: Unterricht
Kapitel 5: Klassenführung
Kapitel 6: Medien
Motivieren
Kapitel 7: Motivation
Kapitel 8: Selbstkonzept
Kapitel 9: Emotionen
Interagieren
Kapitel 10: Familie
Kapitel 11: Lehrer
Kapitel 12: Gleichaltrige
Diagnostizieren und Evaluieren
Kapitel 13: Pädagogisch-psychologische Diagnostik
Kapitel 14: Evaluation pädagogisch-psychologischer Maßnahmen
Kapitel 15: Nationale und internationale Schulleistungsstudien
Intervenieren
Kapitel 16: Pädagogisch-psychologische Lernförderung im Kindergarten- und Einschulungsalter
Kapitel 17: Training
Kapitel 18: Die Förderung psychosozialer Kompetenzen im Schulalter
Lernen
Kapitel 1: Wissenserwerb
1.1 Wissenserwerb – Was wird da erworben?
1.2 Was sind bedeutende theoretische Perspektiven?
1.2.1 Perspektive des aktiven Tuns
1.2.2 Perspektive der aktiven Informationsverarbeitung
1.2.3 Perspektive der fokussierten Informationsverarbeitung
1.2.4 Wahl der Perspektive: Implikationen zur Gestaltung von Lehr-LernArrangements
1.3 Wie kann Wissen erworben werden? – Wichtige Lernformen
1.3.1 Lernen aus Text
1.3.2 Lernen aus Beispielen und Modellen
1.3.3 Lernen durch Aufgabenbearbeiten
1.3.4 Lernen durch Erkunden
1.3.5 Lernen durch Gruppenarbeit
Der Erwerb von Wissen („knowledge acquisition“) ist wohl die wichtigste Zieldimension der meisten Bildungsprozesse. Wird im Kontext von Schule, Hochschule und Weiterbildung der Begriff „Lernen“ gebraucht, so bezieht er sich typischerweise auf Wissenserwerb. Insofern wird im Folgenden Lernen synonym mit Wissenserwerb gebraucht. Zu gelungenem Wissenserwerb trägt eine Vielzahl von Faktoren bei. Dieser Beitrag konzentriert sich auf das Was und Wie des Wissenserwerbs aus kognitiver Perspektive. Dabei werden nur die proximal am Wissenserwerb beteiligten Faktoren und Prozesse betrachtet. Für andere wichtige Faktoren, die hier nur am Rande oder gar nicht behandelt werden können, etwa Vorwissen und Intelligenz (Kap. 2), Selbststeuerung der Lernenden (Kap. 3), Motivation (Kap. 7 und 8) oder Unterricht (Kap. 4, 5 und 6), wird auf die entsprechenden Kapitel dieses Lehrbuchs verwiesen. Im Folgenden wird zunächst die Frage geklärt, welche Wissensarten in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind (Abschn. 1.1). In Abschn. 1.2 werden drei grundlegende theoretische Perspektiven rekonstruiert und deren Implikationen für die Analyse und Förderung des Wissenserwerbs diskutiert. Wichtige Lernarten werden in Abschn. 1.3 besprochen. Abschließend wird noch kurz das Verhältnis zwischen Lernprozessen und Instruktion (Unterricht, instruktionales Design von Lernmaterial und Lernumgebungen) erörtert.
In diesem Beitrag wurde Wissenserwerb insbesondere in Hinblick darauf diskutiert, welche Prozesse zum Aufbau von Wissensstrukturen führen. Es dürfte deutlich geworden sein, dass diese Prozesse nicht immer und von allen Lernenden in optimaler Weise gezeigt werden. Dazu müssten diese als wichtigste Voraussetzung ausreichendes Vorwissen haben (Kap. 2), über geeignete Lernstrategien verfügen, Selbststeuerungskompetenzen aufweisen, um den Lernstrategieeinsatz zu koordinieren (Kap. 3), und sie müssten schließlich ausreichend motiviert sein, um die kognitive Anstrengung der aktiven Auseinandersetzung mit dem Lernstoff auf sich zu nehmen (Kap. 7). Immer wenn diese (und ggf. weitere) Voraussetzungen nicht in hinreichendem Maße erfüllt sind – was eher die Regel als die Ausnahme ist –, kommt dem Unterricht bzw. dem instruktionalen Design von Lernumgebungen besondere Bedeutung zu (Kap. 4). Wenn, um ein bereits genanntes Beispiel nochmals aufzugreifen, Lernende spontan keine Selbsterklärungen zeigen, so sollte das Instruktionsdesign „Prompts“ im Lernmaterial vorsehen, die sie dazu auffordern; oder der Lehrer sollte im Unterricht Selbsterklärungen trainieren. Unterricht und Instruktionsdesign haben also die Aufgabe, die lernrelevanten Prozesse zu trainieren und auszulösen, die von den Lernenden spontan nicht gezeigt werden (können). Das Wissen, das Sie aus diesem Kapitel (hoffentlich) konstruieren konnten, bietet Ihnen eine gute Grundlage, Lehr-Lern-Arrangements und Unterrichtsstile in einem ersten Schritt auf theoretischer Ebene zu beurteilen: Beinhalten sie Elemente, die wichtige kognitive Lernprozesse fördern und die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die zentralen Konzepte und Prinzipien lenken?
Kapitel 2: Intelligenz und Vorwissen
2.1 Eine geheimnisvolle, aber wichtige Sache: epistemologische Überzeugungen
2.2 Grundlegendes: Intelligenztheorien, Wissenstheorien
2.2.1 Grundlegendes zur Intelligenzforschung
2.2.2 Grundlegendes zur Wissenspsychologie
2.3 Zusammenspiel von Intelligenz und Wissen als Gegenstand der Pädagogischen Psychologie
2.3.1 Intelligentes Wissen – Franz Weinerts Sicht auf das Zusammenspiel von Intelligenz und Wissen
2.3.2 Ability Determinants of Skilled Performance – Philip Ackermans Sicht auf das Zusammenspiel von Intelligenz und Wissen
2.3.3 Triarchische Theorie der Intelligenz und praktische Intelligenz – Robert Sternbergs Sicht auf das Zusammenspiel von Intelligenz und Wissen
2.4 Messung von Intelligenz und Wissen
2.4.1 Messung von Intelligenz mit psychometrischer Tradition
2.4.2 Messung von praktischer Intelligenz
2.4.3 Messung von Wissen
2.5 Intelligenter Wissenserwerb im Studium – Auch eine Frage der epistemologischen Überzeugungen von Dozierenden?
Thema dieses Kapitels ist das Zusammenspiel von Intelligenz und Wissen. Beide Begriffe spielen in der Pädagogischen Psychologie eine wichtige Rolle – dennoch werden sie unglücklicherweise in der Forschung oft voneinander getrennt betrachtet. Der Grund hierfür sind unterschiedliche wissenschaftstheoretische Perspektiven und die wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklungen. Die wichtigsten Forschungsrichtungen werden wir in Abschn. 2.2 vorstellen, um die Grundlagen für das Verständnis der Ideen einiger moderner Forscher zu legen, die sich um die Erklärung des Zusammenspiels von Intelligenz und Wissen bemüht haben (Abschn. 2.3). Verfahren zur Messung von Intelligenz und Wissen (Abschn. 2.4) nehmen im Studium der Pädagogischen Psychologie einen wichtigen Platz ein. Anschließend wird dargestellt, wie intelligenter Wissenserwerb im Studium aussehen kann (Abschn. 2.5).
Mit den Ausführungen in diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass die Unterstützung intelligenten Wissenserwerbs voraussetzt, dass zum einen Lernprozesse neu konzipiert werden und zum anderen auch die Ziele des Lernens zu verändern sind. Der Erwerb von Faktenwissen kann nicht mehr vorrangiges Ziel sein, wenn die Wissensvielfalt angestrebt wird, die zur Beschreibung von Expertenhandeln identifziert
wurde. Allerdings müssen pädagogisch-psychologische Instruktionsansätze auch anerkennen, dass der Erwerb (umfangreichen) deklarativen Faktenwissens eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiche Prozeduralisierungsprozesse darstellt – aber eben nicht das Ende der Wissenserwerbsfahnenstange!
Kapitel 3: Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen
3.1 Begrifsbestimmung „Selbstreguliertes Lernen“
3.2 Modelle der Selbstregulation
3.2.1 Prozessorientierte Modelle der Selbstregulation
3.2.2 Schichtenmodelle der Selbstregulation
3.3 Diagnostik von Selbstregulation
3.3.1 Fragebogen
3.3.2 Lerntagebücher
3.3.3 Interviews
3.3.4 Beobachtungsverfahren
3.3.5 Strategiewissenstests
3.3.6 Denkprotokolle & Mikroanalysen
3.4 Förderung von Selbstregulation
3.4.1 Gestaltung und Optimierung von Trainingsmaßnahmen zur Förderung von Selbstregulation
3.4.2 Exemplarische Beschreibung von Trainingsmaßnahmen
3.5 Ausblick
Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, die eigenen Gedanken, Emotionen und Handlungen zielgerichtet zu steuern (vgl. Zimmerman 2000). Sie ist Grundvoraussetzung, um sich Ziele setzen und diese erreichen zu können. Dies gilt für alle Lebensbereiche: für den Sport gleichermaßen wie für das Berufsleben, für die Freizeit ebenso wie für Schule und Studium. Unerlässlich sind selbstregulative Kompetenzen vor allem im schulischen/universitären Alltag. In diesem Zusammenhang sprechen wir von selbstreguliertem Lernen. Die Entwicklung der Fähigkeit zum eigenverantwortlichen, selbstregulierten Lernen wird neben der Vermittlung von Fachwissen als eine der Hauptaufgaben der Bildung und Erziehung junger Menschen gesehen. Aufgrund schnell veraltenden Wissens (z. B. digitale Medien) und einer durch die Globalisierung bedingten Wissensexplosion ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie sich neues Wissen selbstständig aneignen können. Vor allem Lernsituationen jenseits formaler Unterrichtssequenzen (wie z. B. das Lernen für eine Klassenarbeit) erfordern von Schülerinnen und Schülern Lernkompetenzen, die es möglich machen, den Lernprozess selbstständig zu strukturieren und zu refektieren. Zahlreiche empirische Studien (z. B. Dörrenbächer und Perels 2016; Otto 2007a; Perels et al. 2009; Schmitz und Wiese 2006; Zimmerman et al. 2011), die darauf abzielen, selbstreguliertes Lernen zu fördern, zeigen, dass dieser Schlüsselkompetenz eine bedeutende Rolle in allen Lernsituationen zukommt. Die theoretische Modellierung des Konstrukts Selbstregulation ist Grundvoraussetzung für die Diagnostik der Selbstregulation und für entsprechende Interventionen. Infolgedessen stellt das vorliegende Kapitel zunächst ausgewählte Modelle der Selbstregulation und des selbstregulierten Lernens vor. Es folgt eine Darstellung von Verfahren zur Diagnostik selbstregulierten Lernens und daran anschließend von Ansätzen zur Förderung selbstregulierten Lernens. Das Kapitel endet mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder und praktische Herausforderungen.
Insgesamt sollte mit diesem Kapitel deutlich gemacht werden, dass Selbstregulationskompetenzen für erfolgreiches Lernen und Studieren entscheidend sind. Die vielfältigen Forschungsaktivitäten in diesem Bereich haben zur Entwicklung zunehmend differenzierter Modelle der Selbstregulation geführt, die Ausgangspunkt von Erfassungsmethoden und Fördermaßnahmen wurden. Ungeachtet des umfangreichen Kenntnisstands und der Tatsache, dass selbstreguliertes Lernen als ein wichtiges Qualitätskriterium von Schulqualität angesehen wird, ist die Vermittlung von Selbstregulationsstrategien jedoch weder in der Schule, noch im Studium oder im Berufsleben selbstverständlich. Dieses Ungleichgewicht verweist letztlich auf allgemeine Probleme der praktischen Umsetzung von Forschungsergebnissen, die (auch) in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und Hochschullehrern zu verorten sind (Kap. 18).
Lehren
Kapitel 4: Unterricht
4.1 Begrifiche und theoretische Grundlagen
4.1.1 Didaktische Theorien – Modelle für die Planung und Analyse von Unterricht
4.1.2 Aeblis Entwurf einer kognitionspsychologischen Didaktik
4.1.3 Instructional-Design-Modelle
4.1.4 Angebots-Nutzungs-Modell
4.2 Merkmale und Merkmalskonfgurationen erfolgreichen Unterrichts
4.2.1 Strukturiertheit des Unterrichts
4.2.2 Inhaltliche Klarheit und Kohärenz des Unterrichts
4.2.3 Feedback
4.2.4 Kooperatives Lernen
4.2.5 Üben
4.2.6 Kognitive Aktivierung
4.2.7 Metakognitive Förderung
4.2.8 Unterstützendes Unterrichtsklima
4.2.9 Innere Differenzierung, Individualisierung, formatives Assessment und Scaffolding als Formen adaptiven Unterrichts
4.2.10 Lernwirksamer Unterricht für ‚Risikoschüler‘
4.2.11 Zusammenfassung und Einbettung der Befunde
4.2.12 Grenzen
Dieses Kapitel beleuchtet theoretische Grundlagen unterrichtlichen Lehrens und Lernens und gibt einen Überblick über wichtige Ergebnisse der Unterrichtsforschung. Dabei wird sowohl auf kognitive als auch auf affektiv-motivationale Merkmale von Schulerfolg Bezug genommen.
Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage, welche Merkmale einen lernwirksamen und motivationsförderlichen Unterricht charakterisieren und wie sich entsprechende Effekte theoretisch erklären lassen. Den Ergebnissen der herangezogenen Studien zufolge zeichnet sich ein lernwirksamer und motivationsförderlicher Unterricht dadurch aus, dass Lernende einen hohen Anteil ihrer Lernzeit für die Auseinandersetzung mit fachlich relevanten Themen, Konzepten und Kernideen nutzen. Diese werden von der Lehrperson korrekt, verständlich und kohärent präsentiert und zugänglich gemacht. Die Verarbeitung der Inhalte wird durch einen die Lernenden kognitiv aktivierenden Unterricht angeregt und unterstützt. Die kognitive Aktivierung bezieht sich nicht nur auf Phasen der Erarbeitung, sondern auch auf Phasen der Vertiefung, Übung und Anwendung von Inhalten und setzt die Anknüpfung an das Vorwissen der Lernenden voraus. In einem lernwirksamen und motivationsförderlichen Unterricht erhalten die Lernenden zudem konstruktives und inhaltsbezogenes Feedback, das auf ihre Lernvoraussetzungen abgestimmt ist und das sie in ihrem Lernprozess und bei der Selbstregulation unterstützt. Die Lernenden werden systematisch zur Selbststeuerung ihrer Lernprozesse und zum Erwerb von Lernstrategien angeleitet und durch die Schaffung von Lernsituationen herausgefordert, diese metakognitiven Fähigkeiten anzuwenden und zu nutzen.
Lehrpersonen schaffen in einem lernwirksamen und motivationsförderlichen Unterricht außerdem vielfältige Gelegenheiten zum kooperativen Lernen, in denen die Schülerinnen und Schüler herausfordernde und komplexe Aufgaben gemeinsam bearbeiten, sich hierbei wechselseitig unterstützen und aufgabenbezogen interagieren. Die genannten Merkmale verdeutlichen, dass ein lernwirksamer und motivationsförderlicher Unterricht die Spannung zwischen lehrer- und schülerorientiertem Unterricht auföst, indem er auf eine Kombination von Formen direkter und indirekter Instruktion setzt. Wie einige der hier herangezogenen Studienergebnisse zeigen, gelten diese Merkmale „guten“ Unterrichts offenbar nicht nur für analogen Präsenzunterricht in der Schule, sondern auch für digital gestützten und asynchronen Fernunterricht. Wendet man den Blick von der Empirie zur Theorie, so werden in dem Kapitel Bezüge zu unterschiedlichen theoretischen Perspektiven hergestellt, die die Wirkungen der dargestellten Unterrichtsmerkmale erklären können. Dies verweist gleichzeitig darauf, dass die Entwicklung einer konsistenten Theorie des Unterrichts, die die Speziftät der einzelnen Unterrichtsfächer, die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden und die verschiedenen Lernzielniveaus integriert und verbindet, noch aussteht.
Kapitel 5: Klassenführung
5.1 Klassenführung als zentrales Thema der Unterrichtsforschung
5.2 Begrifsklärung
5.3 Der Klassiker: Kounins Techniken der Klassenführung
5.3.1 Disziplinierungsmaßnahmen
5.3.2 Allgegenwärtigkeit und Überlappung
5.3.3 Reibungslosigkeit und Schwung
5.3.4 Gruppenmobilisierung
5.3.5 Abwechslung und Herausforderung
5.3.6 Zusammenfassung und Fazit
5.4 Klassenführung als Umgang mit Störungen
5.5 Klassenführung als Management von Lernzeit
5.6 Klassenführung als Begleitung von Lernprozessen bei Schülern
5.7 Klassenführung als trainierbare Fähigkeit von Lehrenden
Lehrer klagen häufg darüber, dass es im Unterricht an Disziplin mangelt und die Schüler nicht zu bändigen sind. Die Schülerinnen und Schüler klagen ebenfalls: darüber, dass die Lehrer schlecht vorbereitet sind, der Unterricht chaotisch organisiert ist und man sich durch den Lärm der anderen gestört fühlt. Neben den Klagen gibt es aber auch positive Beispiele: Klassenzimmer, aus denen ein dezenter Lärmpegel dringt, der auf eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre hinweist; Klassenzimmer, in denen Lehrende durch die einzelnen Arbeitsgruppen gehen, Hilfestellungen geben, Schüler sich gegenseitig unterstützen und in denen offensichtlich alle wissen, wohin die (Lern-) Reise geht. Das folgende Kapitel behandelt Grundlagen der Klassenführung. Dabei wird die Klassenführung als Komponente der Unterrichtsqualität eingebettet und wichtige Komponenten vorgestellt. Die Grundlagen der Klassenführung werden anhand von Beispielen aus den Forschungsarbeiten von Jacob S. Kounin erläutert. Abschließend werden drei Komponenten der Klassenführung herausgestellt: Umgang mit Störungen, Management von Lernzeit und Begleitung von Lernprozessen.
Bei der Klassenführung handelt es sich um ein Syndrom, das verschiedene Unterrichtsmerkmale bündelt. Zentral ist dabei die Auffassung, Lernumgebungen so zu gestalten, dass Lernen störungsarm abläuft, die vorgegebene Lernzeit maximal ausgeschöpft wird und die Lehrenden die Lernprozesse optimal begleiten und unterstützen. Die empirische Befundlage zur Relevanz dieser Elemente zeichnet ein eindeutiges Bild: Störungsarmer Unterricht hat in der Regel positive Wirkungen auf kognitive, aber auch motivational-affektive Komponenten des Lernens. Die optimale Nutzung von Unterrichtszeit durch die Organisation und Strukturierung des Unterrichts hängt wiederum eng mit der Qualität der Lernprozesse, aber auch der längerfristigen Lernentwicklungen (vor allem im kognitiven Bereich) zusammen. Die Qualität der Begleitung und Unterstützung der Lernprozesse fördern vor allem motivational-affektive Komponenten des Lernens bei Schülern. Der Umgang mit Störungen stellt in gewisser Weise eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen dar; die optimale Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Zeit die Grundlagen für die Ausführung von Lernaktivitäten; die Begleitung des Lernens betrifft die Unterstützung qualitativ hochwertiger Lernprozesse.
Kapitel 6: Medien
6.1 Entwicklung der Medien und Medienforschung
6.1.1 Entwicklung der Medien
6.1.2 Entwicklung der Medienforschung
6.2 Lernmedien
6.2.1 Texte und Hypertexte
6.2.2 Bilder, Animationen und Filme
6.2.3 Multimedia
6.2.4 Medieneinsatz aus medialer Perspektive
6.3 Medien in Bildungskontexten
6.3.1 Formen des Lehrens und Lernens mit Medien
6.3.2 Medien in der Schule
6.3.3 Medien in der Hochschule
6.4 Private Mediennutzung
6.4.1 Musik und Radio
6.4.2 Fernsehen
6.4.3 Computer und Internet
In der heutigen sog. globalisierten digitalen Wissensgesellschaft prägen Medientechnologien das Lernen und Arbeiten sowie das Freizeitverhalten der Menschen in einem größeren Ausmaß als je zuvor. Aufgrund der rasanten technologischen Fortentwicklung im Rahmen der Digitalisierung gilt es, den Einfuss von Medien auf Menschen empirisch zu erfassen, um Hinweise auf einen sinnvollen und erfolgreichen Umgang mit Medien in den verschiedensten Lebenssituationen geben zu können. Auf einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Medien und Medienforschung folgen in Abschn. 6.2 die wichtigsten Befunde und Theorien zur Rezeption text- und bildbasierter Lernmedien. Nach der separaten Betrachtung des Lernens mit Texten und Bildern steht in Abschn. 6.3 das Lernen mit digitalen Lernumgebungen aus kognitionspsychologischer Perspektive im Mittelpunkt der Betrachtung. Abschließend werden in diesem Abschnitt einige wichtige Tipps zur medienbasierten Unterrichtsgestaltung referiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Einsatz digitaler Medien in unterschiedlichen Bildungskontexten liegt. In Abschn. 6.4 werden die wichtigsten Fakten zur Mediennutzung in privaten Kontexten erläutert, wobei sowohl das Mediennutzungsverhalten als auch die Frage zum Einfuss der Medien auf das menschliche Verhalten thematisiert werden.
Das heutige Lehren und Lernen ist ohne Medien nicht mehr vorstellbar. Insbesondere digitale Medien haben zu einem enormen Anwachsen der Lehr- und Lernformen geführt. Um medienbasiertes Lehren und Lernen effzient zu gestalten, ist das Verständnis der kognitiven Prozesse bei der Rezeption von Texten, statischen sowie animierten Bildern und multimedialen Lernumgebungen von Bedeutung, da Lernen in Abhängigkeit vom Medium unterschiedliche kognitive Kompetenzen voraussetzt. Weiterhin ist zu bedenken, dass insbesondere das Vorwissen einen starken Einfuss auf medienbasierte Lernprozesse ausübt. Betrachtet man den Einsatz von Medien in institutionalisierten Bildungskontexten, zeigt sich, dass in der Schule das Lernen mit digitalen Medien bisher erst in geringerem Maße integriert ist als an Hochschulen. Letztlich sind Medien aus pädagogisch-psychologischer Sicht auch als Unterhaltungsmedien von Relevanz, da Medien unseren Alltag und insbesondere unser Freizeitverhalten erheblich bestimmen. Deswegen sind auch die Gründe für das individuelle Medienkonsumverhalten als auch die Auswirkungen des Medienkonsums – insbesondere auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen – von Bedeutung. Um negative Einfüsse von Medien zu vermeiden und ein kompetentes Mediennutzungsverhalten zu erlernen, ist der angeleitete Erwerb von Medienkompetenz entscheidend.
Motivieren
7.1 Unterschiedliche Motivationsformen und -merkmale
7.1.1 Extrinsische und intrinsische Motivation
7.1.2 Dispositionale Motivationsmerkmale
7.2 Bedeutung der Motivation für Lernen und Leistung
7.2.1 Leistungsmotivation
7.2.2 Zielorientierung
7.2.3 Intrinsische vs. extrinsische Motivation
7.2.4 Interesse
7.3 Entwicklung und Förderung motivationaler Merkmale
7.3.1 Leistungsmotivation und Zielorientierung
7.3.2 Interesse und intrinsische Motivation
Motivationale Merkmale und Prozesse werden in der Pädagogischen Psychologie vor allem auf das Lernen bezogen. Der besondere Stellenwert der Motivation für das Lernverhalten und die Leistung ist dabei durch zahlreiche empirische Studien belegt worden (Abschn. 7.2). Diese Studien zeigen, dass bestimmte Formen der Lernmotivation den Lernerfolg unabhängig von kognitiven Lernvoraussetzungen, wie z. B. der Intelligenz, begünstigen, wohingegen andere Motivationsformen den Lernerfolg beeinträchtigen können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Motivation die Lernleistung nicht nur auf einem relativ direkten Weg (z. B. über Aspekte der Informationsverarbeitung) beeinfussen kann. Es gibt darüber hinaus Hinweise auf verschiedene indirekte Auswirkungen von Motivation. Die Motivation beeinfusst nicht nur bildungsbezogene Entscheidungen wie Kurs- und Studienfachwahlen, sondern auch lernbezogene Verhaltensweisen wie die investierte Lernzeit. Die Bedeutung der Motivation ergibt sich nicht nur aus ihrer leistungsförderlichen Wirkung. Vielmehr sind hoch motivierte Lerner bzw. Schüler auch deshalb wünschenswert, weil der Unterricht mit motivierten Schülern konfiktfreier, reibungsloser und effzienter abläuft. Die daraus resultierende Erhöhung von Lernzeit und Erlebensqualität kann wiederum den Lernerfolg begünstigen. Schließlich sind Motivation und (vor allem) Interesse wichtig, weil sie dafür sorgen, dass Schüler auch langfristig danach streben, sich mit bestimmten Fächern auseinanderzusetzen (z. B. in Studium und Beruf). In Übereinstimmung mit dieser Sichtweise hat die neuere, konstruktivistische Instruktionsforschung (Kap. 4) motivationale Variablen zunehmend als wichtige Kriterien erfolgreichen Unterrichts berücksichtigt.
Der hier vorgelegte Überblick zu Aspekten pädagogisch-psychologischer Motivationsansätze verdeutlicht die Existenz relativ vielfältiger motivationaler Merkmale, die zudem in der Regel eine substanzielle Bedeutung für den Lernerfolg in Schule und Studium aufweisen. Es fällt jedoch auf, dass die Beziehungen zwischen den verschiedenen motivationalen Konstrukten nur teilweise als geklärt gelten können. So werden beispielsweise Konstrukte voneinander unterschieden (z. B. das explizite Leistungsmotiv und die Zielorientierungen), die offenkundig starke Überschneidungen aufweisen. Es ergibt sich daher als dringliche Aufgabe für die künftige Forschung, die unterschiedlichen Konzeptionen der Lernmotivation in eine kohärente Rahmentheorie zu integrieren und die Zusammenhänge zwischen ihnen zu klären (z. B. Urhahne 2008). Eine bessere Integration der Konstruktvielfalt wäre nicht nur aus theoretischen, sondern auch aus praktischen Gründen zu begrüßen, denn eine größere theoretische Klarheit würde die Rezeption motivationaler Theorien durch Lehrer, Erzieher, Weiterbilder und andere Praktiker erleichtern und somit die Wahrscheinlichkeit motivationaler Interventionen in den pädagogischen Anwendungsfeldern erhöhen.
Die vorliegenden Befunde zu den Auswirkungen der Motivation auf Lernen und Leistung vermitteln ein insgesamt positives Bild. Ohne Zweifel kommt der Motivation hier eine wichtige Rolle zu, auch jenseits von kognitiven Bedingungsfaktoren. Aber es besteht noch weiterer Klärungsbedarf. Einige Autoren (insbesondere Eccles 1983, 2005; Wigfeld und Eccles 2000) wiesen darauf hin, dass motivationale Lernermerkmale vor allem ausbildungsbezogene Entscheidungen (z. B. Kurswahlen) beeinfussen. Besonders deutlich konnte dies von Köller et al. (2001) für den Einfuss des Interesses auf die Leistungskurswahl im Fach Mathematik demonstriert werden. Dagegen wurde der Einfuss der Motivation auf Leistungsindikatoren als geringer eingeschätzt. Allerdings muss hier wiederum nach Motivationsformen (z. B. Lern- vs. Leistungszielorientierung) und Leistungsformen (z. B. standardisierte Leistungstests vs. Lernleistung in einer spezifschen Textlernsituation) unterschieden werden. Eine wichtige Aufgabe der künftigen Forschung besteht deshalb darin, mehr systematische und differenzierte Kenntnisse über den Zusammenhang von Motivation und akademischen Leistungen zu gewinnen. Zusätzlich wäre es dabei wichtig, auch die Motivationseffekte auf die den Leistungen zugrunde liegenden Lernprozesse zu untersuchen (Brunstein und Heckhausen 2006). Ein praktisch besonders bedeutsamer Befund besteht darin, dass insbesondere für die intrinsische Motivation, das Interesse und die Lernzielorientierung im Laufe der Schulzeit signifkante Abnahmen zu beobachten sind. Um diese Abnahmen wirksam zu bekämpfen, kann auf eine Reihe von Interventionsmöglichkeiten zurückgegriffen werden. Dabei haben die obigen Ausführungen gezeigt, dass trotz aller Verschiedenheit der theoretischen Konzeptionen eine relative große Gemeinsamkeit hinsichtlich der Fördermaßnahmen besteht. Insbesondere die Studien zur Steigerung des Leistungsmotivs belegen, dass auch Lernfreude und Interesse geweckt werden, wenn es gelingt, durch herausfordernde Ziele und günstige Attributionsmuster positive Selbstbewertungen in Leistungssituationen zu erreichen (Rheinberg und Krug 2005; Schiefele und Streblow 2006). Diese Konvergenz der Effekte von motivationalen Interventionen ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Bedürfnisse nach Kompetenz und Selbstbestimmung für die Motivation eine dominierende Rolle spielen (deCharms 1979; Deci und Ryan 1985, 2002).
Kapitel 8: Selbstkonzept
8.1 Schulisches Selbstkonzept
8.2 Theoretische Wurzeln der pädagogisch-psychologischen Selbstkonzeptforschung
8.2.1 William James
8.2.2 Symbolischer Interaktionismus
8.2.3 Gedächtnispsychologische Modelle des Selbstkonzepts
8.2.4 Entwicklungspsychologische Arbeiten
8.2.5 Sozialpsychologische Selbstkonzeptforschung
8.3 Struktur, Stabilität und Erfassung des Selbstkonzepts
8.3.1 Struktur des Selbstkonzepts: Bereichsspeziftät und Hierarchie
8.3.2 Stabilität des Selbstkonzepts
8.3.3 Erfassung des Selbstkonzepts
8.4 Determinanten des Selbstkonzepts: Welche Faktoren beeinfussen die Höhe der fachbezogenen Selbstkonzepte?
8.4.1 Soziale, dimensionale, temporale und kriteriale Vergleichsinformationen
8.4.2 Big-Fish-Little-Pond Effekt
8.4.3 Internal/External-Frame-of-Reference-Modell
8.4.4 Geschlecht und Geschlechterstereotype
8.4.5 Schulischer Kontext und Selbstkonzeptentwicklung
8.5 Wirkungen des Selbstkonzepts
8.5.1 Selbstkonzept und Leistung
8.5.2 Selbstkonzept, Interesse und leistungsthematische Wahlentscheidungen
8.6 Schulische und außerschulische Interventionsmaßnahmen
Erzielt ein Fußballspieler über Monate kein Tor, so heißt es häufg, dass es ihm am nötigen „Selbstvertrauen“ fehlt. Ist eine Schülerin überzeugt, dass ihr Mathematik „liegt“ und machen ihr entsprechend die Mathematikstunden viel Spaß, so sagt ihre Lehrkraft möglicherweise, dass die Mathematik ihr sehr wichtig ist, eben ein zentraler Teil ihres Selbstbilds, ihrer „Identität“. Durchlebt ein Jugendlicher eine Krise, etwa weil wichtige Freundschaften zerbrechen oder er schulischen Misserfolg erlebt, so könnte die Diagnose seiner Umwelt lauten, dass sein „Selbstwertgefühl“ angeknackst ist. So verschieden die drei Beispiele auf den ersten Blick sein mögen, ihnen ist gemein, dass sie das Feld der psychologischen Selbstkonzeptforschung berühren. In diesem Kapitel geht es um schulbezogene und außerschulische Selbstkonzepte. Es soll dargestellt werden, wie sich schulbezogene Selbstkonzepte entwickeln, wodurch sie beeinfusst werden und welche Auswirkungen sie auf das Erleben und Verhalten von Personen haben. Dabei geht es um brisante Fragen: Wie fnden Kinder und Jugendliche ihre Identität? Wieso sind die Leistungen der Mitschülerinnen und Mitschüler dafür verantwortlich, ob ich denke, dass ich in Sprachen gut bin? Und wieso beeinfusst meine Note in Deutsch mein Selbstvertrauen in Mathematik? Zunächst aber sollen im Abschn. 8.1 Klärungen zum Begriff des Selbstkonzepts vorgenommen und im Abschn. 8.2 kurz die theoretischen Wurzeln der pädagogisch-psychologischen Selbstkonzeptforschung beschrieben werden, indem dargestellt wird, wie von James und im symbolischen Interaktionismus über das „Selbst“ gedacht wurde. Zudem werden gedächtnis- und entwicklungspsychologische Selbstkonzeptmodelle skizziert und die Kernmerkmale sozialpsychologischer Selbstkonzeptforschung aufgeführt. In Abschn. 8.3 erfolgt eine eingehende Beschreibung von Struktur, Stabilität und Erfassung des Selbstkonzepts, bevor in Abschn. 8.4 die Determinanten des Selbstkonzepts beschrieben werden. In Abschn. 8.5 wird die Bedeutung des Selbstkonzepts für schulische Leistungen und Wahlentscheidungen dargestellt. In Abschn. 8.6 werden abschließend Möglichkeiten der Förderung des Selbstkonzepts vorgestellt.
Das schulische Selbstkonzept zählt zu den am gründlichsten untersuchten pädagogisch-psychologischen Variablen. Interessant erscheint es vor allem, weil es in Modellen wie dem Big-Fish-Little-Pond-Effekt oder dem I/E-Modell zu Abweichungen von rein rationalen Selbsteinschätzungen kommt. Deutlich geworden ist nicht nur die Abhängigkeit des Selbstkonzepts von schulischen Leistungen und umgekehrt seine Bedeutung für die schulische Leistungsentwicklung. Das Selbstkonzept ist auch in komplexe motivationale Prozesse eingebunden wie Entscheidungen für bestimmte Kurse oder Studienfächer. Zusammengefasst kann die Förderung eines adäquaten und positiven Selbstkonzepts als zentrales Ziel pädagogischer Bemühungen gelten.
Kapitel 9: Emotionen
9.1 Begrifsbestimmung
9.1.1 Emotionen – Mehrdimensionale Konstrukte
9.1.2 Struktur von Emotionen
9.1.3 Verwandte Konstrukte
9.1.4 Emotionsregulation
9.2 Erfassung von Emotionen
9.3 Leistungsemotionen
9.3.1 Defnition und Taxonomisierung
9.3.2 Fachspeziftät von Leistungsemotionen
9.3.3 Auftretenswahrscheinlichkeit von Leistungsemotionen und ihre Bedeutung für Leistung und Wohlbefnden
9.3.4 Versuch einer Abgrenzung von Emotionen und Kognitionen im Lern- und Leistungskontext
9.3.5 Entwicklungsverläufe von Emotionen im Lern- und Leistungskontext
9.3.6 Ursachen von Emotionen im Lern- und Leistungskontext
9.3.7 Wirkungen von Emotionen im Lern- und Leistungskontext
9.3.8 Anregungen zur Gestaltung eines emotionsgünstigen Unterrichts
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Emotionen im Lern- und Leistungskontext. Fragen Sie sich doch einmal selbst – wie fühlen Sie sich, während Sie die Inhalte dieses Lehrbuchs durcharbeiten? Macht Ihnen diese Aufgabe Spaß? Langweilt es Sie? Ärgern Sie sich dabei? Und der Gedanke daran, dass Ihre Lernergebnisse überprüft werden: Jagt er Ihnen einen Schauer über den Rücken oder erfüllt es Sie mit Stolz, Ihre Erkenntnisse und Lösungen präsentieren zu dürfen? Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Emotionen fndet in allen Subdisziplinen der Psychologie statt, viel in der Allgemeinen Psychologie und Klinischen Psychologie, aber auch in der Neuro-, Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Pädagogischen Psychologie. Innerhalb der Pädagogischen Psychologie sind Emotionen einen relativ „junger“ Forschungsbereich. Abgesehen von der traditionellen Prüfungsangstforschung (überblicksartig in Schnabel 1998; Zeidner 2014) wurde der Relevanz von Emotionen im Kontext von Lernen und Leistung in den letzten 20 Jahren durch intensive Forschungstätigkeit Rechnung getragen. In diesem Kapitel werden vorwiegend Arbeiten zu Emotionen im Leistungskontext vorgestellt und Aspekte aus den Nachbardisziplinen dann aufgegriffen, wenn sie für den pädagogischen Kontext relevant sind.
In diesem Kapitel wurden Emotionen als mehrdimensionale Konstrukte mit affektiven, kognitiven, expressiven, physiologischen und motivationalen Komponenten vorgestellt. Basierend auf traditionellen appraisal-theoretischen Ansätzen ist davon auszugehen, dass Emotionen durch die Bewertung von Situationen, Tätigkeiten und der eigenen Person entstehen. Im Lern- und Leistungskontext ist dabei Kontrollund Wert-Appraisals besondere Bedeutsamkeit zuzuschreiben. Diese Bewertung wird durch generalisierte Überzeugungen der Handelnden, aber auch durch äußere Umstände beeinfusst. Lehrkräften ist somit die Möglichkeit gegeben, durch gezielte Gestaltung der Lernumgebung und der Lernaufgaben auf das emotionale Erleben von Schülern Einfuss zu nehmen. Emotionen entfalten Wirkungen auf kognitive Ressourcen während der Aufgabenbearbeitung, auf den Einsatz von Lernstrategien, auf das Ausmaß von Selbstregulation und auf die Motivation während des Lernens. Sie sind somit von großer Bedeutung für resultierende Lernleistungen. Zudem sind sie wichtige Bestandteile des subjektiven Wohlbefndens. Daher sollte die Förderung positiver und die Reduktion negativer Emotionen im Kontext schulischen und außerschulischen Lernens auch als Wert an sich angestrebt werden. Aber nicht nur die Emotionen der Schüler, sondern auch die der Lehrkräfte sind von großer Bedeutung. Sie wirken sich auf die Qualität von Instruktionsprozessen aus – und schließlich ist es auch belohnend für die Lehrkräfte, Schüler zu unterrichten, die von Lernfreude und Interesse an den Lerninhalten erfüllt sind.
Interagieren
Kapitel 10: Familie
10.1 Einleitung
10.2 Die Rolle der Eltern im Verlauf der (Familien-)Entwicklung
10.2.1 Die Gründung einer Familie
10.2.2 Familienleben mit einem Kleinkind
10.2.3 Der Schuleintritt: Eltern als Lernbegleiter und Lehrkräfte als „Erziehungspartner“
10.2.4 Die Transformation der Eltern-Kind-Beziehung im Jugendalter
10.2.5 Familienbande nach der Adoleszenz
10.3 Familien in der Krise
10.3.1 Aufwachsen in einer Ein-Elternteil- oder Stieffamilie
10.3.2 Krankheit als Familienaufgabe
10.3.3 Armut und Arbeitslosigkeit
Familien sind der primäre Entwicklungs- und Bildungskontext von Kindern. Nicht nur in der Kindheit, sondern auch lange danach spielen Familien eine entscheidende Rolle in der Förderung und Unterstützung ihrer Familienmitglieder – nicht zuletzt im hohen Alter. Fraglos ändern sich die Aufgaben und Beziehungen im Verlauf der Familienentwicklung, wobei die jeweilige Lebenslage und der Kontext, in dem das Familienleben stattfndet, eine wichtige Rolle für die Ausgestaltung der Interaktionen spielt. Wie sich die Anforderungen an Eltern im Verlauf der Familienentwicklung wandeln, welchen Einfuss kritische Lebensereignisse auf das Familienleben haben und welche Aspekte des Familienlebens für die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen besonders relevant sind, ist Gegenstand dieses Kapitels.
Die Ausführungen in diesem Kapitel sollten verdeutlichen, dass sich die Anforderungen an Eltern (und deren Kinder) im Verlauf der Familienkarriere stetig verändern und das der Familie innewohnende Potenzial nur dann ausgeschöpft wird, wenn die Eltern-Kind-Interaktion auf die altersabhängigen Bedürfnisse des Nachwuchses und die Fähigkeiten des einzelnen Kindes abgestellt wird. Diese Idee steht daher auch – mehr oder weniger ausdrücklich – im Zentrum vorliegender Trainings zur Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz (zusf. Wiss. Beirat 2005; TschöpeScheffer 2006).
Mit dem innerfamilialen Sozialisationsgeschehen ist eine entscheidende „Stellgröße“ für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Daraus im Umkehrschluss abzuleiten, dass den Eltern grundsätzlich die Verantwortung für kindliche Fehlentwicklungen zuzuschreiben ist, ist gleichwohl unzulässig. Ein solch deterministisches Verständnis verkennt nicht nur die Rolle von Erbanlagen, kindlichen Selbstsozialisationsprozessen jenseits der Familie und bidirektionalen Wirkungen der Eltern-Kind-Interaktion. Es lenkt vielmehr auch von der Tatsache ab, dass Beeinträchtigungen in den Familienbeziehungen häufg auf belastende Lebenslagen und kritische Lebensereignisse zurückgehen und viele unverschuldet in eine Krise gestürzte Eltern dennoch bemüht sind, ihr Kind bestmöglich zu begleiten.
Was eine „gute Erziehung“ ausmacht, lässt sich vor dem Hintergrund der inzwischen über 50 Jahre hinweg betriebenen Erziehungsstilforschung dahin gehend beantworten, dass eine störungsfreie Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen umso wahrscheinlicher wird, je mehr Eltern die für einen autoritativen Erziehungsstil charakteristischen Verhaltensweisen zeigen. So ist es positiv zu bewerten, dass die Voraussetzungen für die Realisierung eines solchen, durchaus anspruchsvollen Erziehungsstils heute in vielerlei Hinsicht besonders günstig sind. Besorgniserregend sind gleichwohl die nach wie vor hohe Zahl von in Armut lebenden Kindern und der Erwartungsdruck, unter dem immer mehr Eltern stehen beziehungsweise unter den sie sich selbst stellen. Nicht zuletzt Befunde der Armuts- und Ungleichheitsforschung unterstreichen, wie stark das Elternhaus die psychosoziale, intellektuelle und schulische Entwicklung der Kinder beeinfusst. Mit Blick auf die Rolle der Familie als einer bedeutsamen Lernumgebung ist festzuhalten, dass neben bildungsaffnen Werthaltungen und positiven Einschätzungen der kindlichen Leistungsfähigkeit durch die Eltern vor allem gemeinsame lernrelevante Aktivitäten und eine qualitätsvolle Ausgestaltung elterlicher Hilfen zielführend sind. Je mehr Eltern Interesse an schulischen Inhalten und an den schulischen Erfahrungen ihrer Kinder zum Ausdruck bringen, diesen klare Leistungserwartungen und Standards vermitteln, die kindliche Zuversicht in die eigene Leistungsfähigkeit stärken, emotionale Unterstützung bei der Bewältigung von Misserfolgen leisten und die Herausbildung von Selbstregulationskompetenzen fördern, umso eher ermöglichen sie ihren Kindern ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Lernen. Die wenigen wissenschaftlich fundierten Ratgeber und Trainings, die auf den elterlichen Umgang mit schulischen Belangen fokussieren (Rammert und Wild 2007; Niggli et al. 2009; McElvany und Artelt 2009; Otto 2009), setzen diese Erkenntnisse in praktische Anleitungen um.
Beeinträchtigungen in der elterlichen Erziehungskompetenz werden wahrscheinlicher, wenn Familien mit unvermittelten Schicksalsschlägen (z. B. Erkrankung eines Familienmitglieds oder plötzliche Arbeitslosigkeit) oder mit Krisen (z. B. Trennung/ Scheidung, fortdauernde ökonomische Deprivation) konfrontiert sind. Aus systemischer Sicht werden in allen diesen Fällen Anpassungsleistungen erforderlich, die zumindest vorübergehend das Erleben und Verhalten der Betroffenen beeinträchtigen können. Ob eine Krise erfolgreich gemeistert wird oder langfristige negative Folgen insbesondere für die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder nach sich zieht, hängt dabei wesentlich von den jeweils verfügbaren (personalen und sozialen) Ressourcen der Familie beziehungsweise ihrer Mitglieder ab. Gleichwohl sind Familien vielfach auf Unterstützung in herausforderungsreichen Situationen angewiesen. Hierzu vorliegende Angebote können auf spezifsche Probleme und Adressaten gerichtet oder eher allgemein präventiver Natur sein (Kap. 18). Beide Ansätze fnden sich beispielsweise in den Programmen der Frühprävention für Familien ab der Schwangerschaft bis zum Kindergartenalter, die im Rahmen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) im Auftrag des BMFSFJ auf den Weg gebracht wurden (Sann 2012; s. auch http://www.nzfh.de). Zentral ist hierbei das Anliegen, die Entwicklungschancen für Kinder durch eine möglichst wirksame Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinderund Jugendhilfe zu verbessern und sie früher und besser vor möglichen Gefährdungen zu schützen. Aber auch in allen nachfolgenden Phasen können Fragen und Probleme auftreten, die den Rückgriff auf professionelle Hilfe sinnvoll machen. Im Fall einer Trennung/Scheidung der Eltern etwa kann auf ein differenziertes Angebot an Beratung, Mediation, aber auch Kursen zurückgegriffen werden (Walper und Bröning 2008). Für Eltern mit Schulkindern sind Beratungslehrer und Schulpsychologen, aber auch die Mitarbeiter in Erziehungsberatungsstellen oft wichtige Ansprechpartner. Leider sind die Hürden bei der Inanspruchnahme professioneller Angebote für viele Familien aber immer noch hoch. Um ein möglichst gesundes, unbelastetes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, muss uns daran gelegen sein, die Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Koordination der vielfältigen Angebote für Familien zu verbessern.
Kapitel 11: Lehrer
11.1 Merkmale des Lehrerberufs
11.1.1 Die Rolle von Lehrkräften: Anforderungen und Erwartungen
11.1.2 Lehrkräfte als Thema in der Pädagogischen Psychologie: Klassische Themen und neuere Trends
11.2 Kognitive Merkmale: Wissen und Überzeugungen
11.2.1 Wissen
11.2.2 Überzeugungen und Erwartungen
11.3 Motivationale Merkmale
11.3.1 Berufswahlmotive
11.3.2 Enthusiasmus
11.3.3 Zielorientierungen
11.4 Emotionale Merkmale
11.4.1 Vielfältige Emotionen und wie Lehrkräfte damit umgehen
11.4.2 Beanspruchungserleben
11.5 Lerngelegenheiten für (angehende) Lehrkräfte
11.5.1 Das Lehramtsstudium
11.5.2 Einstieg in die Praxis: Der Vorbereitungsdienst
11.5.3 Fortbildungen im Beruf
Lehrkräfte sind zentrale Akteure im Bildungssystem. Dass sie einen substanziellen Einfuss auf das Lernen und die Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler haben können, ist auch aus empirischer Sicht unstrittig (Hattie 2009). Forschung zum „Lehrereffekt“ zeigt, dass Schülerinnen und Schüler auch bei gleichen persönlichen Voraussetzungen innerhalb einer Schule systematische Unterschiede in ihren Leistungsentwicklungen zeigen, je nachdem, von welcher Person sie unterrichtet werden (Byrne et al. 2010). Warum jedoch manche Lehrkräfte erfolgreicher als andere sind und welche persönlichen Voraussetzungen dies bestimmen, ist eine wichtige psychologische Fragestellung und soll im vorliegenden Kapitel näher betrachtet werden. Das Anliegen dieses Kapitels ist es, zu zeigen, wie die Pädagogische Psychologie dazu beigetragen hat, Lehrerinnen und Lehrer als wichtige Agenten im Bildungssystem besser zu verstehen. Die Erkenntnisse pädagogisch-psychologischer Forschung liefern Ansatzpunkte für die Verbesserung von Unterricht und sind auch hilfreich, um die berufichen Erfahrungen von Lehrkräften positiv zu gestalten. Um auf das Thema Lehrkräfte einzustimmen, liefern wir zunächst eine Anforderungsanalyse, die die typischen Herausforderungen des Lehrerberufs beschreibt. Anschließend fassen wir Ansätze der pädagogisch-psychologischen Forschung zu Lehrkräften zusammen und erläutern dann, welche Merkmale von Lehrkräften bisher in der Forschung Aufmerksamkeit fanden. Das Kapitel schließt mit einer Beschreibung der Lerngelegenheiten für (angehende) Lehrkräfte.
Die Pädagogische Psychologie beschäftigt sich mit den psychischen Prozessen, die sich innerhalb von pädagogischen Situationen abspielen. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Erleben und Handeln von Lehrkräften ist daher aus mindestens zwei Gründen relevant. Zum einen sind Lehrkräfte maßgeblich dafür verantwortlich, die Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern zu steuern und zu begleiten. Wie wir im vorliegenden Kapitel gezeigt haben, können verschiedene Merkmale der Lehrkräfte ausschlaggebend dafür sein, wie gut ihnen die Gestaltung von unterrichtlichen Lernsituationen gelingt. Eine umfangreiche Wissensbasis über fachliche Inhalte, Methoden und Lernprozesse scheint hilfreich zu sein, um adaptiv auf Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Gleichzeitig weisen viele empirische Befunde darauf hin, dass die Wahrnehmung und Interpretation von Unterrichtsgegebenheiten häufg durch spezifsche Überzeugungen der Lehrenden beeinfusst werden und ihr Handeln bestimmen. Diese Überzeugungen können – wie am Beispiel der Erwartungseffekte gezeigt – somit Einfuss auf das Lernen und Verhalten der Schülerinnen und Schüler nehmen. Dass sich neben kognitiven Aspekten auch motivational-emotionale Lehrermerkmale wie die Freude an der Tätigkeit oder die erlebte Beanspruchung auf das unterrichtliche Handeln auswirken können, wird durch neuere Forschungsergebnisse belegt.
Das Verhalten und Erleben von Lehrkräften ist aber auch aus einem weiteren Grund ein wichtiges Thema für die Pädagogische Psychologie. In neueren Ansätzen wird durchgängig davon ausgegangen, dass nicht angeborene Talente, sondern berufsspezifsche erlernbare Kompetenzen entscheidend sind für eine erfolgreiche Berufsausübung. Es existieren daher verschiedene Ansätze zur Aufrechterhaltung, Verbesserung und Erweiterung von Handlungs- und Unterrichtskompetenzen, die sich an Lehramtsstudierende, angehende Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und ausgebildete Lehrkräfte richten. Lehrer rücken somit selbst als Lernende in den Fokus pädagogischer Interventionen – aus empirischer Sicht ist dieses Thema noch längst nicht erschöpfend erschlossen.
Kapitel 12: Gleichaltrige
12.1 Bedeutung und Funktion der Gleichaltrigengruppe
12.2 Beliebtheit und Freundschaft
12.2.1 Beliebtheit
12.2.2 Freundschaft
12.3 Merkmale von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichem Peer-Status
12.3.1 Beliebtheit als soziale Akzeptanz: Welche Kinder und Jugendlichen werden gemocht, welche werden eher abgelehnt?
12.3.2 Beliebtheit als Reputation: Welche Kinder und Jugendlichen gelten als beliebt?
12.3.3 Ursachen für die positiven Korrelationen zwischen sozialer Akzeptanz und Schulleistungen
12.4 Beziehungen zwischen Gruppen von Gleichaltrigen
12.4.1 Gruppenzugehörigkeit als Teil der eigenen Identität: Soziale Identität und Intergruppenbeziehungen
12.4.2 Gleich und gleich gesellt sich gern: Homophilie
12.4.3 Wie aus sozialen Normen Gruppendruck wird: Konformität
12.5 Miteinander und voneinander lernen
12.5.1 Überwindung von gruppenbedingten Feindseligkeiten durch kooperative Lernformen
12.5.2 Peer Educator als Wissenvermittler
12.5.3 Aggression und Bullying
12.5.4 Fokus: Spezifsche Defzite aggressiver Kinder in der sozialen Informationsverarbeitung
12.5.5 Fokus: Bullying als soziales Geschehen im Klassenkontext
12.5.6 Maßnahmen gegen Aggression und Bullying an Schulen: Prävention und Intervention
„Worauf freust du dich in der Schule?“ – Welche spontanen Antworten sind auf diese Frage zu erwarten? Fragen Sie Ihre Nichte, das Nachbarskind, den Sohn Ihrer Freundin; versetzen Sie sich in Ihre Schulzeit zurück und überlegen Sie, was Sie selbst geantwortet hätten. Würde die Freude daran, Neues zu lernen und zu verstehen, als Erstes genannt werden? Vermutlich nicht. Die Schule ist allein durch die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche dort den überwiegenden Teil ihrer (mehr oder weniger) wach verbrachten Zeit zubringen, der zentrale Ort für sie, um Freundschaften zu knüpfen und sich mit Gleichaltrigen zu treffen. Und genau dieses wird auch am häufgsten als die positive Seite von Schule empfunden: Man freut sich darauf, in der Schule die Freundin zu sehen, mit den anderen Kindern zu spielen oder mit der Clique auf dem Schulhof herumzustehen (z. B. Spiel et al. 2018; Wentzel et al. 2014). Im folgenden Kapitel wird es darum gehen, welche Bedeutung und Funktion Gleichaltrige für Kinder und Jugendliche haben. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bereich „Schule und Lernen“. Was ist das Besondere an den Beziehungen zwischen Heranwachsenden, in welcher Hinsicht bieten sie einander etwas, mit dem weder Eltern noch Lehrkräfte aufwarten können? Welche Arten von Beziehungen lassen sich im Klassenkontext beschreiben? Was ist Beliebtheit und was hat Beliebtheit im Klassenverband mit schulbezogenen Merkmalen wie Motivation und Leistung zu tun? Wie lässt sich die Abgrenzung verschiedener Cliquen voneinander erklären? Wie kann bei problematischen Interaktionen wie Bullying interveniert werden?
In diesem Kapitel haben wir uns mit der Funktion und Bedeutung von Peers beschäftigt. Dabei wurde dargestellt, wie die Interaktion mit Gleichaltrigen Kinder und Jugendliche in ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung fördert und welche Rolle die Position im Klassenverband sowohl für das Wohlbefnden als auch für die schulischen Leistungen spielt. Auch die spezifschen Entwicklungsaufgaben des Kindes- und Jugendalters machen die Peers zu einer wichtigen Orientierungshilfe und Unterstützung. Wie gut die Bewältigung dieser Aufgaben gelingt, hängt wesentlich davon ab, wie wirkungsvoll ein Kind oder Jugendlicher die Unterstützung durch Gleichaltrige nutzen kann. So kann die Bildung von Cliquen als ein zentraler Faktor für die Ausbildung sozialer Identitäten gelten. Dabei sind jedoch ebenfalls die potenziellen Konfikte zwischen sich voneinander abgrenzenden Gruppierungen zu berücksichtigen. Auch insgesamt stehen neben den positiven Auswirkungen von gelingenden Peerkontakten die negativen Folgen von aggressiven Verhaltensweisen unter Schülern, die den Schulgang für zahlreiche Kinder und Jugendliche zur Qual werden lassen. Programme zur Verringerung von Bullying und Aggression gehören deshalb in vielen Schulen zum selbstverständlichen Repertoire.
Diagnostizieren und Evaluieren
Kapitel 13: Pädagogisch-psychologische Diagnostik
13.1 Defnition und Zielstellungen von Diagnostik
13.1.1 Defnition pädagogisch-psychologischer Diagnostik
13.1.2 Diagnostische Ziele
13.1.3 Anwendungsgebiete und Nachbardisziplinen der pädagogischen Diagnostik
13.2 Beurteilung psychologischer Messverfahren
13.2.1 Besonderheiten bei der Messung psychologischer Merkmale
13.2.2 Gütekriterien zur Beurteilung psychologischer Messverfahren
13.2.3 Testtheorie: Konkurrierende Ansätze und adäquate Methoden
13.2.4 Klassifkatorische Diagnostik
13.3 Diagnostische Verfahren und diagnostische Daten
13.3.1 Lebensdaten
13.3.2 Zensuren
13.3.3 Selbstberichtsinstrumente
13.3.4 Testdaten: Intelligenz- und Schulleistungsdiagnostik
13.3.5 Interviews und Beobachtungsinventare
13.4 Abschließende Kommentare
Im Alltag schreiben wir Personen, die uns umgeben, häufg mit großer Selbstverständlichkeit bestimmte Ausprägungen von Eigenschaften wie „Intelligenz“ oder „soziale Kompetenz“ zu. Die Datengrundlage und unsere Fähigkeit, zu zutreffenden Urteilen zu kommen, sind dabei oft unzureichend. Somit ermöglichen informelle Daten und unsere Urteilsfähigkeit kaum zuverlässige und korrekte Aussagen über nicht direkt beobachtbare psychische Eigenschaften wie „Gewissenhaftigkeit“ oder „mathematische Begabung“. In diesem Kapitel werden wir darauf eingehen, wie wir in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik zu geeigneten Beobachtungen gelangen und darauf aufbauend fundierte diagnostische Beurteilungen abgeben können. Hierzu werden zunächst Defnitionen, Ziele und Anwendungsgebiete der pädagogisch-psychologischen Diagnostik erörtert. In einem zweiten Abschnitt werden methodische Grundlagen der Beurteilung diagnostischer Instrumente besprochen. Im dritten Abschnitt gilt die Aufmerksamkeit der Beurteilung und exemplarischen Darstellung verschiedener Informationsquellen und -arten.
Pädagogisch-psychologische Diagnostik befasst sich mit der Erfassung nicht direkt beobachtbarer Merkmale von Personen oder Institutionen mit dem Ziel der Beantwortung einer konkreten Fragestellung. Ausprägungen der interessierenden Merkmale werden aufgrund von beobachtetem Verhalten geschätzt. In Bezug auf diagnostische Fragestellungen werden drei Dimensionen unterschieden: Status- und Prozessdiagnostik, Selektions- und Modifkationsdiagnostik sowie kriteriums- und normorientierte Diagnostik.
An die pädagogisch-psychologische Diagnostik werden Fragestellungen aus vielfältigen Anwendungsfeldern herangetragen, die von der Diagnose der Teilleistungsstörungen bis zu Fragen der Hochschulzulassung reichen. Zur Beantwortung diagnostischer Probleme werden neben demografschen Angaben und Schulnoten insbesondere Leistungstests, Fragebögen und Interviews herangezogen. Im diagnostischen Prozess kommt der Auswahl geeigneter Verfahren eine besondere Bedeutung zu. Bei der Beurteilung der infrage kommenden Messinstrumente sollten neben Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität insbesondere inhaltliche Abwägungen zum Tragen kommen.
Diagnostische Entscheidungen können schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Daher muss man sich der möglichen Fehler, die bei einer diagnostischen Entscheidung entstehen können, bewusst sein und sollte versuchen, diese durch die Verwendung adäquater Verfahren und Methoden zu minimieren.
Kapitel 14: Evaluation pädagogisch-psychologischer Maßnahmen
14.1 Begrifsbestimmung
14.2 Die acht Schritte einer wissenschaftlichen Evaluation
14.2.1 Entstehungszusammenhang von Evaluationen
14.2.2 Begründungszusammenhang von Evaluationen
14.2.3 Verwertungszusammenhang von Evaluationen
14.3 Überprüfung der Wirksamkeit von Interventionen
14.4 Methodische Probleme bei Evaluationen
14.4.1 Reifungs- und Entwicklungseffekte
14.4.2 Äquivalenzprobleme
14.4.3 Stichprobenmortalität
14.4.4 Hierarchische Daten
14.5 Standards für Evaluationen
14.6 Beispiel für eine wissenschaftliche Evaluation
Als angewandte Disziplin bietet die Pädagogische Psycho
logie eine Vielzahl von Präventions- und Interventionsprogrammen im schulischen und außerschulischen Kontext an (Kap. 17). Motivationstrainings (z. B. Rheinberg und Krug 1999) und Denktrainings (Klauer 1993) sind Beispiele für Interventionen bzw. Maßnahmen auf der Mikro- bzw. Individualebene; Unterrichtsentwicklungsprogramme stellen Interventionen auf einer Mesoebene dar, und schließlich sind Schulreformen Maßnahmen auf der Makro- oder Systemebene. Die Pädagogische Psychologie ist nicht nur bemüht, die Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen theoriebasiert zu entwickeln, sie bedient sich vielmehr auch der entsprechenden sozialwissenschaftlichen Methoden und statistischen Verfahren, um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen. Erfolg bedeutet hier, dass die Zielvariablen der Maßnahmen/Interventionen optimiert werden; im vorschulischen und schulischen Kontext können dies motivationale, soziale und emotionale Variablen ebenso wie die kognitive Entwicklung sein. Die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen wird als Evaluation, das dazu gehörige wissenschaftliche Vorgehen als Evaluationsforschung bezeichnet. Im Rahmen dieses Kapitels soll eine Einführung in die Grundlagen der Evaluation gegeben werden. Begonnen wird mit einer Präzisierung dessen, was genau unter einer Evaluation zu verstehen ist und welche Formen der Evaluation unterschieden werden können. Danach wird der Ablauf einer Evaluation in acht Schritten von der Entscheidung, überhaupt eine Evaluation durchzuführen, bis hin zum Ziehen von Konsequenzen aus den Evaluationsbefunden skizziert. Abschn. 14.3 widmet sich der Überprüfung der Wirksamkeit von Evaluationen, in Abschn. 14.4 werden verschiedene methodische Probleme beschrieben, die bei der Durchführung und Auswertung von Evaluationen entstehen können. Hieran schließt sich ein kurzer Abschnitt an, in dem international gültige Standards für Evaluationsvorhaben vorgestellt werden. Abschn. 14.6 beinhaltet dann die Beschreibung eines konkreten Evaluationsvorhabens.
In den angewandten Disziplinen der Psychologie, zu denen auch die Pädagogische Psychologie zählt, wird wissenschaftlich fundiertes Wissen genutzt, um in verschiedenen praktischen Kontexten Zielvariablen zu optimieren. In pädagogisch-psychologischen Zusammenhängen zielen die Maßnahmen vor allem auf die Förderung von Lernenden ab. Mit diesem Kapitel wurde der Versuch unternommen zu dokumentieren, welche Anforderungen an die Abläufe einer wissenschaftlichen Evaluation solcher Maßnahmen gestellt werden, welche Probleme auftreten können und welche Ansätze zu ihrer Lösung existieren. Allein eine Evaluationsforschung, die sich an ihren eigenen, hoch gesetzten wissenschaftlichen Standards orientiert, kann aussagekräftige Ergebnisse zur Effzienz von Interventionsprogrammen liefern. Dies erfordert große Sorgfalt in den jeweiligen Schritten der Evaluation und hohe Expertise aufseiten derjenigen, die die Evaluation verantworten. Die angesprochenen methodischen Herausforderungen (Umgang mit fehlenden Werten, Umgang mit hierarchischen Daten) sollten in diesem Zusammenhang deutlich gemacht haben, dass ein sehr hohes methodisches Know-how vonnöten ist, um zu validen Aussagen auf der Basis der generierten Daten zu gelangen.
Gleichzeitig wurde aber auch argumentiert, dass potenzielle Restriktionen des Umfeldes, in dem eine Evaluation stattfndet, nicht selten im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Ansprüchen des Evaluators stehen. Evaluationen werden demzufolge immer wieder das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen Auftraggeber und -nehmer sein.
Kapitel 15: Nationale und internationale Schulleistungsstudien
15.1 Was können Schüler? Das Interesse an Schülerleistungen
15.1.1 Outputsteuerung von Bildungssystemen
15.1.2 Evaluation und Qualitätssicherung im Bildungssystem: Ein Rückblick
15.1.3 Bildungsmonitoring heute
15.2 Klassifkation von Vergleichsstudien
15.3 Drei beispielhafte Vergleichsstudien
15.3.1 Flächendeckende Erhebung des Lern- und Leistungsstands: VERA
15.3.2 Eine Internationale Vergleichsstudie: PISA
15.3.3 Überprüfen von Bildungsstandards
15.4 Vergleichsstudien – Von der Idee zur Testdurchführung
15.4.1 Designs und Stichproben
15.4.2 Theoretische Rahmenkonzeptionen
15.4.3 Testkonstruktion und Itementwicklung
15.4.4 Itemanalysen und Skalierung
15.5 Auswertungsverfahren und Ergebnisse (mit Beispielen)
15.5.1 Vergleiche von Gruppen
15.5.2 Kompetenzstufen
15.5.3 Disparitäten
15.5.4 Analysen von Zusammenhängen und deren Grenzen
15.5.5 Trends – 369 15.5.6 Vergleichsstudien als politische Instrumente?
15.6 Erweiterungen von Vergleichsstudien
15.6.1 Ergänzungen
15.6.2 Systematische Vernetzung von Vergleichsstudien mit pädagogisch-psychologischer Forschung
15.7 Ausblick: Aktuelle Trends bei Vergleichsstudien
für Kultusminister: Versetzung gefährdet. – Kinder besser als die Schulen. – Zehn Jahre Pisa: Die Bildungsschocker. – Für derlei Schlagzeilen sorgten in Deutschland im letzten Jahrzehnt PISA und andere Vergleichsstudien. Deren Ergebnisse führen in der Regel zu intensiven Bildungsdiskussionen und tragen an vielen Stellen dazu bei, unser Bildungssystem weiterzuentwickeln. Immer wieder werden solche Studien aber auch kritisiert, da sie beispielsweise einseitig von Wirtschaftsinteressen beeinfusst seien oder deutsche Schüler aufgrund bestimmter Aufgabenformate benachteiligten. Das vorliegende Kapitel beschreibt zentrale Aspekte der theoretischen Fundierung, der Testkonstruktion und der Interpretation der Ergebnisse von internationalen und nationalen Schulleistungsstudien und legt dar, welche Funktionen diese Studien im Bildungssystem übernehmen können. Abschn. 15.1 beleuchtet zunächst den historischen Zusammenhang, aus dem Schulleistungsstudien entstanden sind. Abschn. 15.2 betrachtet Schulleistungsstudien systematisch: Welche Varianten solcher Studien gibt es und wie kann man sie klassifzieren? Welche Studien ziehen internationale und welche nationale Vergleiche? Anhand dreier Beispiele wird in Abschn. 15.3 ein Spektrum von Schulleistungsstudien vorgestellt. Danach behandeln wir die theoretischen Grundlagen und die verschiedenen Konzeptionen, technische und methodische Voraussetzungen, wie Designs und Stichproben sowie Besonderheiten der Datenerhebung und -aufbereitung (Abschn. 15.4), und wenden uns Fragen der Auswertung und der Ergebnisdarstellung zu (Abschn. 15.5). Wie jeder Forschungszugang haben auch Schulleistungsstudien nur eine begrenzte Reichweite. Deshalb gehen wir auf ihre Grenzen in Abschn. 15.6 ein und beschreiben verschiedene Ergänzungen und Erweiterungen im Design bzw. in den Stichproben von Schulleistungsstudien, die den beschriebenen Problemen Rechnung tragen. In diesem Zusammenhang wird auch thematisiert, wie Fragestellungen sich entwickeln: Schulleistungsstudien werden erweitert, um bestimmte Fragen aus der pädagogisch-psychologischen Forschung tiefergehend bearbeiten zu können. Darüber hinaus tragen Befunde aus der pädagogisch-psychologischen Forschung zur Weiterentwicklung der Studien bei (Abschn. 15.7). Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf aktuelle Trends bei Vergleichsstudien.
Bildungssystemen mithilfe eines empirisch fundierten Bildungsmonitoring regelmäßig überprüft und auf der Grundlage der zusammengetragenen Daten gesteuert und verbessert. Zentral ist dabei die Frage, wie gut ein Schul- bzw. Bildungssystem seinen Aufgaben gerecht wird. Schulleistungsstudien oder Vergleichsstudien gehören als wichtiger Bestandteil zu einem systematischen Bildungsmonitoring. Sie haben zum Ziel, in ihrer Testkomponente Auskunft über den Stand der Kompetenzen einer Personengruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Bildungskarriere zu geben. Neben diesen wichtigen Ergebnissen (Outputs) von Bildungsprozessen werden auch Prozess- und Kontextfaktoren berücksichtigt, die Aussagen über die Wirkungsweise eines Bildungssystems erlauben (beispielsweise über Chancengerechtigkeit). Diese Daten werden meist über Fragebögen erhoben. Die inhaltliche Ausrichtung einer Vergleichsstudie wird in ihrer Rahmenkonzeption festgelegt: Unter Rückgriff auf eine bildungstheoretische Auffassung und den aktuellen Forschungsstand in der Domäne bildet die Rahmenkonzeption die Grundlage der Test- und Fragebogenkonstruktion. Abhängig von ihren Fragestellungen legen Vergleichsstudien unterschiedliche Perspektiven an: Sie geben Auskunft über den Zustand des Bildungssystems im (internationalen) Vergleich mit anderen Systemen, sie lassen sich anhand von inhaltlichen Kriterien (z. B. Kompetenzstufen) verorten und geben – bei wiederholten Erhebungsrunden – Auskunft über Veränderungen über die Zeit. Um diesen Fragen nachgehen zu können sind Vergleichsstudien spezifsche Designs zugrunde gelegt. Die Auswertung von Vergleichsstudien erfolgt mit Modellen der Item-Response-Theorie. IRT-Modelle sind am besten geeignet, präzise Aussagen über die Ergebnisse für Personengruppen (und nicht auf Individualebene) zu machen und Aufgabenschwierigkeit und Personenfähigkeit auf derselben Skala zu messen. Die Ergebnisse von Vergleichsstudien beschreiben die Stärken und Schwächen eines Bildungssystems und geben viele wertvolle Hinweise zu seiner Steuerung. Die begrenzte Reichweite und die eingeschränkten „Interpretationsmöglichkeiten“ von Vergleichsstudien, die jeweils spezifsche Fragen verfolgen und meist nicht kausal interpretierbare Ergebnisse liefern, geben Impulse für Forschungsarbeiten, die an den Verfahren und Ergebnissen von Vergleichsstudien ansetzen und Erkenntnisse und Zusammenhänge in Small-Scale-Studien überprüfen und vertiefen. Eine besondere Herausforderung für die Zukunft ist es, in der Anlage und Umsetzung von Vergleichsstudien auf Veränderungen in den Bildungszielen (beispielsweise durch Veränderungen im IT-Bereich; auch Kap. 6) sensibel und zeitnah zu reagieren. Die Entwicklungen von Kompetenzen und Kontextmerkmalen über die Zeit, die sogenannten Trends, methodisch fundiert zu beschreiben, ist eines der bedeutsamen Probleme in der Forschung zu Vergleichsstudien. Computerbasiertes und adaptives Testen stellen bedeutsame Fortschritte für die Durchführung von Vergleichsstudien dar, die notwendigen Vorarbeiten dazu sind jedoch bisher nicht vollsständig erledigt.
Intervenieren
Kapitel 16: Pädagogisch-psychologische Lernförderung im Kindergarten- und Einschulungsalter
16.1 Notwendigkeit vorschulischer Fördermaßnahmen
16.1.1 Die präventive Funktion vorschulischer Fördermaßnahmen
16.1.2 Inhaltliche Schwerpunkte beim Einsatz von pädagogisch-psychologischen Trainingsprogrammen
16.1.3 Fazit
16.2 Sprachförderung in Kindergarten und Vorschule
16.2.1 Möglichkeiten einer effektiven Sprachförderung
16.2.2 Evaluationsstudien zur Wirksamkeit des dialogischen Lesens
16.2.3 Fazit
16.3 Förderung des induktiven Denkens
16.3.1 Möglichkeiten einer effektiven Förderung induktiven Denkens
16.3.2 Evaluationsstudien zur Wirksamkeit von Denktrainings
16.4 Förderung von Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs
16.4.1 Die Bedeutung von phonologischer Bewusstheit und BuchstabenLaut-Zuordnung in der schriftsprachlichen Entwicklung
16.4.2 Möglichkeiten einer effektiven Förderung von phonologischer Bewusstheit und Buchstaben-Laut-Zuordnung
16.4.3 Evaluationsstudien zur Wirksamkeit der Förderung von phonologischer Bewusstheit und Buchstaben-Laut-Zuordnung
16.5 Förderung mathematischer Kompetenzen im Kindergarten und im Schuleingangsbereich
16.5.1 Die Bedeutung von Zahl-Größen-Kompetenzen in der mathematischen Entwicklung
16.5.2 Möglichkeiten einer effektiven Förderung von Zahl-GrößenKompetenzen
16.5.3 Evaluationsstudien zur Wirksamkeit der Förderung von Zahl-GrößenKompetenzen
Die Kinder eines Einschulungsjahrgangs bringen bereits am ersten Schultag sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen mit. Diese Unterschiede haben einen nachhaltigen Einfuss auf die weitere Schullaufbahn. Mit dem Ziel ungünstigen Entwicklungsverläufen frühzeitig vorzubeugen, wird in den letzten Jahren ein immer größeres Augenmerk auf Möglichkeiten der vorschulischen Prävention gerichtet. Da das konventionelle Bildungsangebot in dieser Hinsicht bislang wenig erfolgreich ist, bieten sich insbesondere pädagogisch-psychologisch fundierte Förderansätze an. Diese stützen sich nicht nur auf solide theoretische Grundlagen, sondern können in vielen Fällen auch empirische Wirksamkeitsnachweise vorlegen. Das vorliegende Kapitel befasst sich mit der Frage, in welchen Lernbereichen die Implementation von pädagogisch-psychologisch fundierten Präventionsmaßnahmen besonders sinnvoll ist, welche vorschulisch vorhandenen (Vorläufer-)Kompetenzen für diesen Zweck vielversprechende Ansatzpunkte bieten, welche konkreten Förderansätze jeweils existieren und welche empirischen Befunde bislang zur Wirksamkeit dieser Maßnahmen vorliegen.
Die pädagogisch-psychologische Interventionsforschung hat inzwischen eine Reihe theoretisch fundierter Förderansätze hervorgebracht, die problemlos in die institutionellen Förderangebote des Kindergartens implementierbar sind und deren präventive Potenziale für die spätere Schullaufbahn auch empirisch belegt werden konnten. Am wenigsten zufriedenstellen kann die Lage im Bereich der Sprachförderung. Zwar liegen hier (inzwischen auch für den deutschen Raum) positive Befunde zum dialogischen Lesen vor, das auf der systematischen Anwendung einfacher Sprachlehrstrategien basiert (Ennemoser et al. 2013). Allerdings ist zu vermuten, dass eine systematische, jeweils gezielt auf bestimmte Ebenen der Sprachkompetenz fokussierte Vorgehensweise zusätzliche Potenziale birgt. Diese können jedoch durch undifferenzierte „Paketevaluationen“ nicht eindeutig ausgemacht werden und benötigen einen kleinschrittigeren Vorlauf an Interventionsstudien (für eine Kritik an so genannten „horse races“ in der Evaluationsforschung vgl. Pressley und Harris 1994). Deutlich ermutigender sind die Befunde zur Förderung des induktiven Denkens, die zeigen, dass die entsprechenden Maßnahmen langfristige Transfereffekte zeigen, welche auch in erwarteter Weise auf ein breites Spektrum an Lernleistungen transferieren. Angesichts der relativ eindeutigen Befundlage wäre jedoch eine stärkere Dissemination in die institutionelle Förderpraxis wünschenswert.
Die Förderung der phonologischen Bewusstheit hat unter den vorgestellten Ansätzen die mit Abstand längste Tradition und sie verzeichnet dementsprechend auch die größte Verbreitung in die Praxis. So können die Entwicklungen in diesem Bereich zweifelsohne als Erfolg für die pädagogisch-psychologische Interventionsforschung gewertet werden. In der Praxis wird allerdings häufg die Notwendigkeit übersehen, die Maßnahmen mit der Vermittlung von Buchstabe-Laut-Beziehungen zu verknüpfen. Wird dies nicht umgesetzt, ist mit deutlich geringeren Effekten zu rechnen. Zudem werden die Maßnahmen häufg nicht programmgetreu, sondern eher sporadisch und selektiv durchgeführt, was den empirischen Befunden zufolge sehr schnell die eigentlich vorhandenen Förderpotenziale untergräbt (z. B. Schneider et al. 1997; vgl. auch Pressley und Harris 1994). Nicht zuletzt bleibt festzuhalten, dass Maßnahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit zweifelsohne einen wichtigen Präventionsansatz darstellen. Insbesondere mit Blick auf die späteren Leseverständnisleistungen können sie jedoch eine präventive Förderung der „allgemeinen“ Sprachkompetenz (morphosyntaktische Fähigkeiten, Wortschatz) nicht gänzlich ersetzen.
Die Förderung spezifscher Vorläuferfertigkeiten im Bereich Mathematik wurde demgegenüber erst in den letzten zehn Jahren zunehmend in den Blick genommen. Dennoch sind in diesem Zeitraum enorme Fortschritte erzielt worden, indem im Rahmen theoretischer Modellkonzeptionen zentrale Meilensteine identifziert werden konnten, die einen wirksamen Ansatzpunkt für gezielte und nachweislich wirksame Präventionsmaßnahmen liefern (Krajewski und Ennemoser 2013).
Kapitel 17: Training
17.1 Was ist ein Training? Begrifsbestimmung und Klassifkation
17.2 Training kognitiver Grundfunktionen
17.2.1 Aufmerksamkeit
17.2.2 Denken
17.3 Motivationstraining
17.4 Training kultureller Grundkompetenzen am Beispiel des Lesens und Schreibens
17.4.1 Training des Leseverständnisses
17.4.2 Schreiben
17.5 Implementation von Trainingsprogrammen
Lernerfolg wird wesentlich durch die kognitiven, motivationalen und selbstregulativen Fähigkeiten des Lernenden bestimmt. Es verwundert daher nicht, dass in der Pädagogischen Psychologie spezielle Verfahren entwickelt wurden, die sich den Aufbau und die Verbesserung solcher Fähigkeiten zum Ziel setzen. Von solchen Trainingsverfahren handelt dieses Kapitel.
Zusammenfassend lässt sich zur Implementation von Trainingsprogrammen feststellen, dass die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen maßgeblich von der Qualität der Umsetzung bestimmt wird und dass eine systematische Erforschung von Implementationsprozessen zu den Desideraten der Trainings- und Unterrichtsforschung gehört (Gräsel und Parchmann 2004; Hasselhorn et al. 2014; Philipp und Souvignier 2016). Wesentliche Faktoren, die bei einer erfolgreichen Implementation beachtet werden sollten, beziehen sich auf die Sicherung der Akzeptanz gegenüber den neuen Konzepten, auf die Bereitstellung praxistauglicher Materialien und eine Unterstützung der langfristigen Übernahme von Trainingsprinzipien – auch über die konkreten Programme hinaus – in den Förder- und Unterrichtsalltag.
Kapitel 18: Die Förderung psychosozialer Kompetenzen im Schulalter
18.1 Primärpräventive Förderkonzepte für Kinder und Jugendliche als Zielgruppe
18.1.1 Förderkonzepte für einzelne Problembereiche
18.1.2 Problemübergreifende Förderprogramme
18.1.3 Förderung des Umgangs mit kritischen Lebensereignissen
18.2 Primärpräventive Förderkonzepte für Eltern als Zielgruppe
18.3 Organisationsbezogene primärpräventive Förderkonzepte
18.3.1 Maßnahmen auf Klassenebene
18.3.2 Maßnahmen auf Schulebene
18.3.3 Maßnahmen auf makrosozialen Ebenen
18.4 Evaluation der Efekte von Programmen zur Förderung psychosozialer Kompetenzen
18.5 Maßnahmen zur Optimierung von Programmefekten
Mit dem Beginn der Grundschulzeit wartet nicht nur die Schultüte mit ihren süßen Versprechungen auf die Schulanfänger. Sie müssen sich die Aufmerksamkeit eines Lehrers mit oftmals 25 anderen Kindern teilen. Haben einige Kinder im Kindergarten möglicherweise noch den Umgang mit Schere und Stift aufgrund von Schwierigkeiten in der Feinmotorik vermieden, werden sie nun in diesen Bereichen herausgefordert und benötigen die notwendige Frustrationstoleranz. Was bereits im Kindergarten galt, gilt in der Schule umso mehr. In der großen Gruppe einer Klasse wird verlangt, sich sozial kompetent zu verhalten: eigene Emotionen wahrnehmen und regulieren, Perspektivenübernahme, positive Beziehungen eingehen und halten, Regeln des Miteinanders einhalten, angemessene Konfiktlösestrategien zeigen etc. Die Anforderungen sind groß. Gleichzeitig bestimmt diese psychosoziale Seite des Lernens auch einen nicht zu vernachlässigen Teil des Lernerfolgs und des Wohlbefndens in der Klasse. Doch auch außerhalb der Schule sind psychosoziale Kompetenzen wichtig. Das folgende Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung in die primärpräventive Förderung psychosozialer Kompetenzen. Anschließend wird ein Überblick über verschiedene Förderkonzepte gegeben. Abschließend wird auf besondere Aspekte der Evaluation und Möglichkeiten zur Optimierung solcher Fördermaßnahmen eingegangen.
Angemessene psychosoziale Kompetenzen stellen eine wichtige Ressource dar, die positive Auswirkungen auf die weitere Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben. Auswirkungen fnden sich beispielsweise Schulleistungen und letztendlich die psychische und körperliche Gesundheit. Der Förderung psychosozialer Kompetenzen kommt damit ein wichtiger Stellenwert zu. Während in den USA durch große Programme wie z. B. das Head Start Programm (McKey et al. 1985) die Diskussion und Forschung bezüglich einer frühen Förderung größere Ausmaße angenommen hat, werden in Deutschland vergleichsweise kleinere Projekte durchgeführt. Wie das Kapitel aufzeigt, liegt auf der anderen Seite eine Vielzahl von universell, indiziert und selektiv ausgerichteten präventiven Maßnahmen für das Kindes- und Jugendalter vor, die sich entweder an die Betroffenen selbst oder das soziale Umfeld richten. Zudem liegen im pädagogisch-psychologischen Bereich weitere Methoden und Maßnahmen vor, die sich in den Schulalltag integrieren lassen. Wünschenswert wäre, dass einzelne Programme nicht punktuell und losgelöst von anderen Maßnahmen durchgeführt werden, sondern die Förderung psychosozialer Kompetenzen beispielsweise als selbstverständlicher Bestandteil des gesamten schulischen Lernens angesehen und gelebt wird.